Friedrich Hahn, Die Heimsuchung
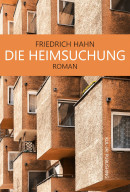 Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“
Wer im literarischen Kosmos des Friedrich Hahn Heldin oder Held sein will, muss sich die Qualität eines Sandkorns im Stundenglas zulegen. Der mehrdeutige Begriff „Heimsuchung“ stellt sich im höheren Alter oft in den Weg einer glatten Biographie. Einerseits ist darunter eine soziale Einrichtung zu verstehen, worin Pflege und Obsorge als kleines Paradies angeboten werden, andererseits lässt sich eine amorphe Lebenssituation durchaus als pure Bedrohung deuten. „Ist die Suche nach dem Heim abgeschlossen, beginnt die Heimsuchung.“
Im Mittelpunkt des Romans steht der einundsiebzigjährige Siegi, der im Heim an der Uferstraße untergekommen ist. In seiner aktiven Zeit hat er als Tierpfleger in Schönbrunn gearbeitet, aber das frühere Leben spielt ab nun keine Rolle mehr, hier wird jeder an seinem Handicap gemessen, das er zu bewältigen hat. Siegi hat einen „welken“ Fuß und geht am Stock, zur Einführung in die neue Lebenssituation leiht er sich einen Rollator aus und umrundet die neue Wohnstatt.

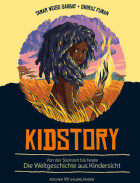 „Bestimmt hast du schon einiges über Geschichte gehört, und vielleicht hast du sogar schon Bücher über wichtige Staatslenker, über alte Städte, berühmte Entdeckungen und außergewöhnliche Ereignisse aus der Vergangenheit gelesen. Aber die Geschichte ist so viel mehr als das. Geschichte ist auch und vor allem die Geschichte von uns allen: alles, was ganz gewöhnlichen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, eben solche wie du, erleben.“ (S. 6)
„Bestimmt hast du schon einiges über Geschichte gehört, und vielleicht hast du sogar schon Bücher über wichtige Staatslenker, über alte Städte, berühmte Entdeckungen und außergewöhnliche Ereignisse aus der Vergangenheit gelesen. Aber die Geschichte ist so viel mehr als das. Geschichte ist auch und vor allem die Geschichte von uns allen: alles, was ganz gewöhnlichen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, eben solche wie du, erleben.“ (S. 6)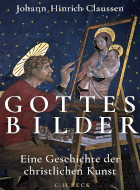 „Selten kann man sich so fremd fühlen, wie beim Besuch eines Museums mit alten christlichen Bildwerken. […] Deshalb versucht dieses Buch, eine Art Ausstellung zu gestalten. Sie besteht aus zwölf Sälen, die einen Weg von den Anfängen durch die wichtigsten Epochen bis zur Gegenwart anbieten und einen Überblick über wesentliche Formen, Gattungen, Motive und Themen zu geben.“ (S. 15)
„Selten kann man sich so fremd fühlen, wie beim Besuch eines Museums mit alten christlichen Bildwerken. […] Deshalb versucht dieses Buch, eine Art Ausstellung zu gestalten. Sie besteht aus zwölf Sälen, die einen Weg von den Anfängen durch die wichtigsten Epochen bis zur Gegenwart anbieten und einen Überblick über wesentliche Formen, Gattungen, Motive und Themen zu geben.“ (S. 15)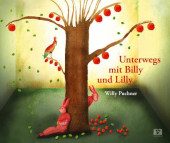 „Zu Weihnachten bekommt Anna eine wunderschöne rote Häsin. Sofort verliebt sie sich in das kuschelige Stofftier. Da Anna ihre Häsin Lilly nicht überallhin mitnehmen kann, wünscht sie sich von Herzen, dass Lilly nicht mehr allein ist. Nachdem Anna eingeschlafen ist, schwebt ein roter Hase in einer Walfisch-Gondel über ihrem Bett.“
„Zu Weihnachten bekommt Anna eine wunderschöne rote Häsin. Sofort verliebt sie sich in das kuschelige Stofftier. Da Anna ihre Häsin Lilly nicht überallhin mitnehmen kann, wünscht sie sich von Herzen, dass Lilly nicht mehr allein ist. Nachdem Anna eingeschlafen ist, schwebt ein roter Hase in einer Walfisch-Gondel über ihrem Bett.“ Die ideale Shortstory ist ein fiktionaler Kitt zwischen zwei scheinbar realen Situationen. Sie kann folglich jederzeit an jedem Ort auftreten und verändert ihr Erscheinungsbild zusammen mit dem Plot, den sie vorgibt zu erzählen.
Die ideale Shortstory ist ein fiktionaler Kitt zwischen zwei scheinbar realen Situationen. Sie kann folglich jederzeit an jedem Ort auftreten und verändert ihr Erscheinungsbild zusammen mit dem Plot, den sie vorgibt zu erzählen.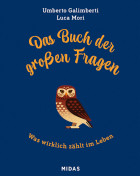 „Kinder werden nicht weise geboren, doch im Gegensatz zu den Unwissenden hören sie nicht auf, Fragen zu stellen – Fragen, die von den Erwachsenen oft ignoriert werden. Die Fragen der Kinder bleiben also unbeantwortet, dabei könnten sie die Antworten, die sich die Erwachsenen auf ihre eigenen Probleme gegeben haben, infrage stellen und so ihre Sicht der Welt verändern.“ (S. 20)
„Kinder werden nicht weise geboren, doch im Gegensatz zu den Unwissenden hören sie nicht auf, Fragen zu stellen – Fragen, die von den Erwachsenen oft ignoriert werden. Die Fragen der Kinder bleiben also unbeantwortet, dabei könnten sie die Antworten, die sich die Erwachsenen auf ihre eigenen Probleme gegeben haben, infrage stellen und so ihre Sicht der Welt verändern.“ (S. 20)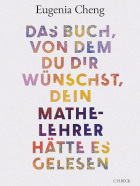 „Ich möchte beschreiben wie Mathe sich anfühlt. Sie fühlt sich nämlich ganz anders an, als viele es sich vorstellen. Ich werde die kreative Seite der Mathematik beschreiben, die phantasievolle, die forschende, die auf Erkenntniszuwachs aus ist; […]. Dies ist kein Mathe-Lehrbuch und auch kein Buch über die Geschichte der Mathematik. Es ist ein Buch über Mathe-Gefühle.“ (S. 10)
„Ich möchte beschreiben wie Mathe sich anfühlt. Sie fühlt sich nämlich ganz anders an, als viele es sich vorstellen. Ich werde die kreative Seite der Mathematik beschreiben, die phantasievolle, die forschende, die auf Erkenntniszuwachs aus ist; […]. Dies ist kein Mathe-Lehrbuch und auch kein Buch über die Geschichte der Mathematik. Es ist ein Buch über Mathe-Gefühle.“ (S. 10)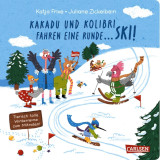 „Eule, Bär und Reh toben durch den … Schnee. Kakadu und Kolibri fahren eine Runde … Ski.“
„Eule, Bär und Reh toben durch den … Schnee. Kakadu und Kolibri fahren eine Runde … Ski.“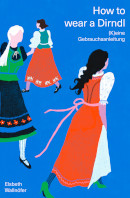 Wenn etwas als Luftikus-Ereignis für gute Laune sorgen soll, steht es der Wissenschaft nicht gut an, durch tiefernste Forschung die Stimmung zu vermasseln. Das Dirndl ist ein Dresscode für gute Laune, Freizeit und ausgelassene Stimmung, das bevorzugte Einsatzgebiet ist das Münchner Oktoberfest, auf dem vermutlich niemand wegen seiner großer Gedanken unterwegs ist.
Wenn etwas als Luftikus-Ereignis für gute Laune sorgen soll, steht es der Wissenschaft nicht gut an, durch tiefernste Forschung die Stimmung zu vermasseln. Das Dirndl ist ein Dresscode für gute Laune, Freizeit und ausgelassene Stimmung, das bevorzugte Einsatzgebiet ist das Münchner Oktoberfest, auf dem vermutlich niemand wegen seiner großer Gedanken unterwegs ist.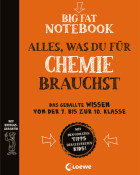 „Was ist Chemie? Chemie ist der Wissenschaftszweig, der Stoffe untersucht – welche Eigenschaft Stoffe haben und wie sie sich verändern. Alles was du siehst, berührst, hörst, riechst und schmeckst sind chemische Stoffe. Chemie untersucht die Eigenschaften von Stoffen, wie sie wechselwirken und wie sie sich verändern.“ (S. 2)
„Was ist Chemie? Chemie ist der Wissenschaftszweig, der Stoffe untersucht – welche Eigenschaft Stoffe haben und wie sie sich verändern. Alles was du siehst, berührst, hörst, riechst und schmeckst sind chemische Stoffe. Chemie untersucht die Eigenschaften von Stoffen, wie sie wechselwirken und wie sie sich verändern.“ (S. 2)