Ruth Aspöck, Der Krieg nach dem Frieden
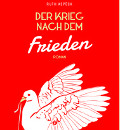 In der Geschichtsschreibung gibt es zwar Modelle für Kriegserklärungen, Schlachten und Friedensverträge, aber kaum eine Erzählform kümmert sich um die Auswirkungen dieser großen Veranstaltungen auf das Individuum.
In der Geschichtsschreibung gibt es zwar Modelle für Kriegserklärungen, Schlachten und Friedensverträge, aber kaum eine Erzählform kümmert sich um die Auswirkungen dieser großen Veranstaltungen auf das Individuum.
Ruth Aspöck wählt eine besondere Form der Familienaufstellung, um den Übergang des Krieges in eine sogenannte normale Weltordnung zu dokumentieren. Dabei teilt sie die Rollen in straff eingegrenzte Ideal-Typen auf, die Figuren sind freiwillig Gefangene von Ideen und versuchen durch Klarheit mit diesen Rollen zurechtzukommen.

 „Und unsere Sache heißt: Was ist eigentlich die Philosophie!“ Sofort hebt Lisa die Hand wie in der Schule. „Philosophie ist die Lehre der Weisheit.“ Na, da ist aber eine heute sehr früh aufgestanden und hat im Lexikon nachgeschaut.“ (10)
„Und unsere Sache heißt: Was ist eigentlich die Philosophie!“ Sofort hebt Lisa die Hand wie in der Schule. „Philosophie ist die Lehre der Weisheit.“ Na, da ist aber eine heute sehr früh aufgestanden und hat im Lexikon nachgeschaut.“ (10) Bücher über das österreichische Schul- und Bildungswesen haben meist eine Kreissäge eingebaut, mit der sie in schrillen Tönen das Sujet zerschneiden und keinen Stein auf dem anderen lassen.
Bücher über das österreichische Schul- und Bildungswesen haben meist eine Kreissäge eingebaut, mit der sie in schrillen Tönen das Sujet zerschneiden und keinen Stein auf dem anderen lassen. Für besonders abartige Realitätsvorfälle haben unsere Sinnesorgane Abwehrmechanismen entwickelt, damit wir möglichst unversehrt bleiben. In der Literatur gibt es freilich Arrangements von Geschichten, die an diese Grenze heran gehen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, „das will ich nicht wissen“, und die Neugierde uns dazu treibt, die Geschichte bis zur letzten Zeile auszuschlürfen.
Für besonders abartige Realitätsvorfälle haben unsere Sinnesorgane Abwehrmechanismen entwickelt, damit wir möglichst unversehrt bleiben. In der Literatur gibt es freilich Arrangements von Geschichten, die an diese Grenze heran gehen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, „das will ich nicht wissen“, und die Neugierde uns dazu treibt, die Geschichte bis zur letzten Zeile auszuschlürfen.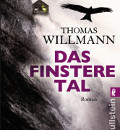 Das ist in der Literatur ganz selten, dass eine Tirol-Ikone vom Cover glänzt und der ganzen Welt zeigt, wie ein echter Tiroler drein schaut.
Das ist in der Literatur ganz selten, dass eine Tirol-Ikone vom Cover glänzt und der ganzen Welt zeigt, wie ein echter Tiroler drein schaut.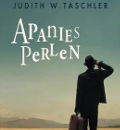 Am witzigsten wird die Literatur immer dann, wenn die Realität so kompakt ins Unwahrscheinliche verdichtet wird, dass man sie nur mehr mit Schmunzeln und Gelächter aushalten kann. Der von der Germanistik so geliebte Realismus kippt ins Sagenhafte, wenn sich auf jeder Seite eine neue Ungehörigkeit auftut.
Am witzigsten wird die Literatur immer dann, wenn die Realität so kompakt ins Unwahrscheinliche verdichtet wird, dass man sie nur mehr mit Schmunzeln und Gelächter aushalten kann. Der von der Germanistik so geliebte Realismus kippt ins Sagenhafte, wenn sich auf jeder Seite eine neue Ungehörigkeit auftut.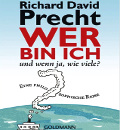 „Wie passen die philosophischen, die psychologischen und die neurobiologischen Erkenntnisse über das Bewusstsein zusammen? Stehen sie sich im Weg, oder ergänzen sie sich? Gibt es ein „Ich“? Was sind Gefühle? Was ist das Gedächtnis?“ (12)
„Wie passen die philosophischen, die psychologischen und die neurobiologischen Erkenntnisse über das Bewusstsein zusammen? Stehen sie sich im Weg, oder ergänzen sie sich? Gibt es ein „Ich“? Was sind Gefühle? Was ist das Gedächtnis?“ (12) „Blumengeister! Das sind Blumengeister!“, schrie Jessica begeistert. Blumengeister, gibt’s die?“, wunderte sich Robert. „Nein, das glaub ich nicht.“ „So schau doch!“ „Ich seh noch immer nichts. Nein, Blumengeister, die gibt’s nicht!“ Oder etwa doch? (32)
„Blumengeister! Das sind Blumengeister!“, schrie Jessica begeistert. Blumengeister, gibt’s die?“, wunderte sich Robert. „Nein, das glaub ich nicht.“ „So schau doch!“ „Ich seh noch immer nichts. Nein, Blumengeister, die gibt’s nicht!“ Oder etwa doch? (32)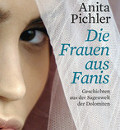 Die heftigste Literaturform ist das Fragment, die wesentlichen Geschichten lassen sich nur als Fragment erzählen, das Fragment ist vollkommen, weil es unvollendet ist.
Die heftigste Literaturform ist das Fragment, die wesentlichen Geschichten lassen sich nur als Fragment erzählen, das Fragment ist vollkommen, weil es unvollendet ist. Straßen werden als Verbindungskanäle zwischen Kulturen literarisch hoch gelobt, die Wirtschaft schätzt sie als Fundamente des Handels und das Kapital als Ort intensiven Investments, wenn man wieder einmal die Maschinen auffahren lässt.
Straßen werden als Verbindungskanäle zwischen Kulturen literarisch hoch gelobt, die Wirtschaft schätzt sie als Fundamente des Handels und das Kapital als Ort intensiven Investments, wenn man wieder einmal die Maschinen auffahren lässt.