Peter Pessl, Der Brief mit der Aufschrift
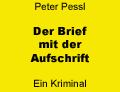 Fehlende Dinge deuten oft auf etwas Kriminelles hin. So kann eine unvollständige Anschrift letztlich genau so zu einem Täter führen wie die Bezeichnung Kriminal, von der offensichtlich ein Teil fehlt. Ist es ein Kriminalroman, ein Kriminalbeamter, eine Kriminalgroteske?
Fehlende Dinge deuten oft auf etwas Kriminelles hin. So kann eine unvollständige Anschrift letztlich genau so zu einem Täter führen wie die Bezeichnung Kriminal, von der offensichtlich ein Teil fehlt. Ist es ein Kriminalroman, ein Kriminalbeamter, eine Kriminalgroteske?
Peter Pessl lässt in seinem Kriminal-Buch so gut wie alles offen. Die Sätze werden nur angedeutet, Szenen erscheinen im Halbschatten, der zweite Teil eines Dialogs fehlt fast immer, ständig werden Situationen aufgerissen und offen gelassen.

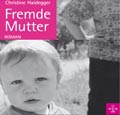 Wie kann man einen Draht zur Geschichte entwickeln, wenn einem nicht einmal die eigene Mutter bekannt ist? - Die „fremde Mutter“ ist in Christine Haideggers Roman einmal eine biographisch ausgelöschte Person, zum anderen aber auch die Geschichte überhaupt.
Wie kann man einen Draht zur Geschichte entwickeln, wenn einem nicht einmal die eigene Mutter bekannt ist? - Die „fremde Mutter“ ist in Christine Haideggers Roman einmal eine biographisch ausgelöschte Person, zum anderen aber auch die Geschichte überhaupt.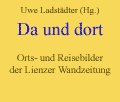 "Osttirol. Das könnte die DDR Tirols sein, aber das ist es nicht." – Da und dort handelt von Osttirol, wie es in der Welt liegt, wie die Bewohner immer frecher werden und Selbstbewusstsein entwickeln, wie es sich überall auf der Welt eine tolle Heimat entwickeln lässt, wenn man genug Humor dafür mitbringt, und wie da und dort prächtige Literatur entsteht, wenn man sie aufkommen lässt.
"Osttirol. Das könnte die DDR Tirols sein, aber das ist es nicht." – Da und dort handelt von Osttirol, wie es in der Welt liegt, wie die Bewohner immer frecher werden und Selbstbewusstsein entwickeln, wie es sich überall auf der Welt eine tolle Heimat entwickeln lässt, wenn man genug Humor dafür mitbringt, und wie da und dort prächtige Literatur entsteht, wenn man sie aufkommen lässt.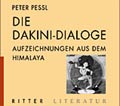 Manchmal geht auch die Fiktion auf Expedition und kehrt mit einem Rucksack voller Kultgegenstände und semantisch frisch kolorierter Bilder auf den Europäischen Kontinent zurück.
Manchmal geht auch die Fiktion auf Expedition und kehrt mit einem Rucksack voller Kultgegenstände und semantisch frisch kolorierter Bilder auf den Europäischen Kontinent zurück.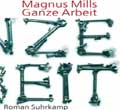 Manchmal reißt einen ein edler Umschlag mit poliertem Werkzeug in die düsterste Materie. Magnus Mills hat nichts Größeres vor, als die komplette Arbeitswelt als Wahnsinn darzustellen, uns Leser darin zu verstricken und dann das ganze mit Ironie in die Luft zu jagen.
Manchmal reißt einen ein edler Umschlag mit poliertem Werkzeug in die düsterste Materie. Magnus Mills hat nichts Größeres vor, als die komplette Arbeitswelt als Wahnsinn darzustellen, uns Leser darin zu verstricken und dann das ganze mit Ironie in die Luft zu jagen.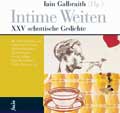 Obwohl Schottland ein weltbekanntes Land ist, und sei es nur wegen der kriminell guten Nebelbänke und des perfekten Whiskys, kennt fast niemand schottische Literatur. Und schon gar nicht schottische Gedichte.
Obwohl Schottland ein weltbekanntes Land ist, und sei es nur wegen der kriminell guten Nebelbänke und des perfekten Whiskys, kennt fast niemand schottische Literatur. Und schon gar nicht schottische Gedichte.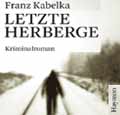 Kein Milieu ist vor Kriminalität sicher, das macht den Beruf eines Kommissars so aufregend, er gerät nämlich mit jedem Fall in ein spezielles Milieu.
Kein Milieu ist vor Kriminalität sicher, das macht den Beruf eines Kommissars so aufregend, er gerät nämlich mit jedem Fall in ein spezielles Milieu.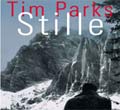 Wieder einmal ist das Gebirge jenes Trampolin, in das sich Mittfünfzigjährige voller Erschlaffung fallen lassen in der Hoffnung, dass noch etwas Tolles wird aus dem Leben.
Wieder einmal ist das Gebirge jenes Trampolin, in das sich Mittfünfzigjährige voller Erschlaffung fallen lassen in der Hoffnung, dass noch etwas Tolles wird aus dem Leben.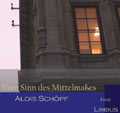 Ein guter Essay fährt wie eine Frechheit unter die Haut, wohltuend schräg, überspitzt, vielleicht auch falsch. Man will als Leser ständig kontern und weiß, dass das die Kunst des Essays ist: den Leser aus der Reserve zu locken.
Ein guter Essay fährt wie eine Frechheit unter die Haut, wohltuend schräg, überspitzt, vielleicht auch falsch. Man will als Leser ständig kontern und weiß, dass das die Kunst des Essays ist: den Leser aus der Reserve zu locken. Musik ist bei Thomas Meinecke mehr als das Handling von Tönen, genau genommen gibt es ja auch eine Musik der Geschichte, eine Musik der Erotik, und alles, was zwischen zwei Körpern abläuft, ist letzten Endes so etwas wie Musik.
Musik ist bei Thomas Meinecke mehr als das Handling von Tönen, genau genommen gibt es ja auch eine Musik der Geschichte, eine Musik der Erotik, und alles, was zwischen zwei Körpern abläuft, ist letzten Endes so etwas wie Musik.