 Die Digitalisierung hat sich in den letzten Jahrzehnten über alle Bereiche der Bildung und des Lernens ausgebreitet und damit auch die Kulturtechniken Lesen und Schreiben spürbar verändert. Lesen und Schreiben haben sich speziell bei den jüngeren Generationen zunehmend in den digitalen Raum verlagert, während die Lesekompetenz laut Studien fortlaufend im Sinken begriffen ist.
Die Digitalisierung hat sich in den letzten Jahrzehnten über alle Bereiche der Bildung und des Lernens ausgebreitet und damit auch die Kulturtechniken Lesen und Schreiben spürbar verändert. Lesen und Schreiben haben sich speziell bei den jüngeren Generationen zunehmend in den digitalen Raum verlagert, während die Lesekompetenz laut Studien fortlaufend im Sinken begriffen ist.
Erkenntnisse der Kognitions- und Neurowissenschaft weisen darauf hin, dass die Erlernung von Lesen und Schreiben sowohl sprachliche als auch kognitive und sensorische Entwicklungsprozesse fördert. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Handschrift als wichtige Kulturtechnik für die kognitive Entwicklung und das Sprachverständnis. Dies widerspricht so manchen Forderungen, die auf das Erlernen der Handschrift in der Grundschule aufgrund der digitalen Medien wenig Wert legen.
Die Aufsatzsammlung von Julia Knopf und Eva Wagner (Hg.), „Schriftspracherwerb und Digitalisierung. Band 1 Theorie“ sowie „Schriftspracherwerb und Digitalisierung. Band 2 Praxis“ beleuchten den Einsatz digitaler Medien im Schriftspracherwerb und zeigt deren Angebote, Möglichkeiten und Grenzen in kritischen Beiträgen auf. Die wichtigsten Erkenntnisse und Hinweise daraus sollen im Folgenden zusammengefasst werden.
Lesen- und Schreibenlernen mit digitalen Medien
Digitale Medien fordern beim Lesen und Schreiben eine Fülle neuer Kompetenzen und Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, sowohl bei der Ausarbeitung von Beiträgen als auch beim Lesen, wenn verschiedenen Formate wie Text, Verlinkungen, Bilder, Audios und Videos miteinander verknüpft werden und damit den Umfang und die Qualität der Informationen vergrößern. Dies stellt Verfasser und Rezipienten vor neue Herausforderungen im kritischen Umgang mit Informationen, wie die Fähigkeit, mit Hilfe der Technologie mit anderen Personen zu kommunizieren, sich in den sozialen Medien richtig zu bewegen, aber auch die Technologie selbst und den Wahrheitsgehalt von Information zu hinterfragen.
Studien über die Auswirkungen, wenn bereits Kleinkinder mit digitalen Medien aufwachsen, sprechen eine deutliche Sprache. Eine US-Studie aus dem Jahr 2017 zeigt, dass eine klare Abhängigkeit zwischen der Sprachentwicklung von Kindern und der zeitlichen Nutzung von digitalen Medien besteht. (Vgl. Knopf, Schriftspracherwerb und Digitalisierung. Band 1 Theorie, S. 27)

Digitale Medien fordern von den Schülern beim Lesen und Schreiben
eine Fülle neuer Kompetenzen.
Die Feinmotorik spielt bei der Entwicklung des Schriftspracherwerbs, für die Artikulation des Sprechens und die Umsetzung von Gedanken in Schrift eine besonders wichtige Rolle. Die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben erfordert eine komplexe psychomotorische Leistung, die von zahlreichen Entwicklungsvoraussetzungen getragen wird. Dazu gehören psychische Befindlichkeiten, sensorische, kognitive und sprachliche Fähigkeiten ebenso wie motorische Steuerungsfähigkeiten, soziale Anforderungen und institutionelle Bedingungen.
Sprachentwicklung und Schrifterwerb gelingen dann am besten, wenn die Kinder eine Verbindung zwischen sprachlicher Äußerung und eigenem Erleben herstellen können. Voraussetzung dafür ist es, die Grundlagen der mündlichen Sprache zu beherrschen. Kinder müssen einen Reim erkennen können, aber auch, ob ein Satz vollständig ist oder nicht. Sie müssen zunächst lernen Wörter in Sätzen zu erfassen oder Wörter in Silben zu gliedern. Phonologisches Bewusstsein im engeren Sinn bildet sich dann mit dem Lesenlernen in der 1. Klasse.
Die Körperkoordination, wie z.B. die Raumkoordination spielen für das Lesen und Schreiben eine wichtige Rolle, wie. die Unterscheidung „links-rechts“ für das Unterscheiden und Erkennen von Buchstaben wie b und d. Kognitions- und Neurowissenschaften konnten die enge Verbindung von körperlicher Bewegung und Lernen bestätigen. Auch das Sprechen im Alltag zeigt, wie schwer sich Sprechen und Gestikulieren voneinander zu trennen lassen.
„Fremdsprachen zu erlernen, gelingt besser mit begleitenden Bewegungen und Gesten.“
(Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 33)
Dies lässt sich auch für das Verhältnis von Handschrift zum Lesen- und Schreibenlernen festhalten, wo Bewegungsmuster zu Bausteinen des Denkens werden. Im Gegensatz zum Tippen oder Sprechen von Texten benötigt das Schreiben von Schrift und Zeichen mit der Hand mehr Gehirnaktivität, weshalb sich deren Inhalte besser einprägen. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 37)
Ein Zusammenhang zwischen Handschreiben, Rechtschreiben und das Verfassen von Texten gilt als gesichert, da für alle drei Fertigkeiten dieselben Gehirnregionen aktiv sind. Für das Handschreiben hat sich gezeigt, dass damit die Gedächtnisleistung ebenso erhöht wird, wie die Aktivität verschiedener Gehirnregionen durch die körperliche Tätigkeit. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 45)
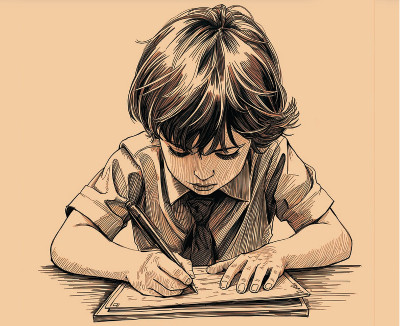
Handschreiben, Rechtschreiben und das Verfassen
von Texten stehen in einem engen Zusammenhang.
Es ist somit von großer Bedeutung, Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihre sogenannte Embodied Cognition, also ihr Körperbewusstsein, ihre Wahrnehmungsfähigkeiten, graphomotorische Fähigkeiten u.a. zu entwickeln, die wesentliche Grundlagen für die Schriftspracherwerbung sind. Gleichzeitig soll durch die Entwicklung der Handschrift auch einer frühzeitigen Abhängigkeit von digitalen Medien entgegengetreten werden. Dabei müssen sich Lesen- und Schreibenlernen und digitale Medien aber nicht grundsätzlich ausschließen, wenn die Bedingungen für Entwicklungsprozesse kindergerecht gestaltet werden und reale Erfahrungen nicht durch digitale Beschäftigungen ersetzt werden. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 38 f)
Der schulische Unterricht sieht sich vor die Frage gestellt, wie sie auf die Digitalisierung alle Lebensbereiche reagieren soll. Mit dem Internet hat nicht nur die Quantität an Texten unterschiedlichster Art massiv zugenommen, sondern sich durch die Verbindung mit Bildern und Filmen sowie die Verlinkung mit zusätzlichen Inhalten die Qualität der Informationen verändert.
Damit stellen die digitalen Inhalte und Angebote neue Herausforderungen sowohl an die Kinder und Jugendlichen als auch an die Lehrer, die den Schülern den kritischen Umgang mit diesen Techniken, die Möglichkeiten aber auch Gefahren, vermitteln sollen. Digitale Medien zeichnen sich dadurch aus, dass sie die unterschiedlichsten Medien miteinander verknüpfen können und Kommunikation, Kooperation und Simulation über große Distanzen in kürzester Zeit ermöglichen.
Für den Lese- und Schreibunterricht ergeben sich damit zahlreiche Schwierigkeiten sowohl für Vermittlung von Techniken für das kritische Lesen als auch im Umgang mit einem sprachlich verkürzten Schreiben in den sozialen Medien, das dem schulischen Sprachunterricht entgegenwirkt.
Beim digitalen Lesen spielt das Medium, ob Smartphone, Tablet, E-Book-Reader, Laptop, Computer etc. ebenso eine Rolle wie das Verhältnis von Text, Bild, Audio und Video. Diese fördern unterschiedliche Lese-Modi die vom geduldigen, genauen Lesen, dem Hineinleben in einen Text bis hin zum raschen Überfliegen und Ausschöpfen von Texten reichen.
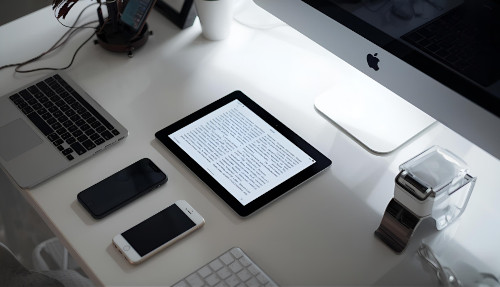
Das Lesen von Bücher, gedruckten Texten, auf dem Smartphone,
Tablet, E-Book-Reader, am Laptop oder Computer fördert
unterschiedliche Arten des Lesen.
Die Auswirkungen und Veränderungen digitaler Lese- und Schreibprozesse werden in der Forschung recht unterschiedlich diskutiert. So führen Nicholas Carr, Maryanna Wolf, Ulrike Gaiser und Manfred Spitzer die zunehmende Ausstattung von Schülern mit digitalen Geräten für den Unterricht auf Unwissen der Verantwortlichen und kommerzielle Interessen der High-Tech-Unternehmen zurück. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 64)
Hypertextuelle Strukturen am Bildschirm gefährden das Erfassen, Analysieren und Durchdenken komplexer Zusammenhänge sowie die Entwicklung von Empathie. Deshalb spielen gerade in der frühen Kindheit gedruckte Bücher eine besonders wichtige Rolle, weil das Gehirn auf diese anders reagiert als beim Lesen in digitalen Medien. Eine besonders große Gefahr stellt aber vor allem ein unkontrollierter Medienkonsum im frühkindlichen Alter dar, durch den schlicht die Zeit für wichtige körperliche Entwicklungen fehlt, wie dreidimensionales Erfassen, die Ausbildung der Fein- und Grobmotorik aber auch soziale und wechselseitige Erfahrungen.
In der von fast 200 Wissenschaftlern auf dem Gebiet des Lesens, Publizierens sowie der Lese- und Schreibkompetenz unterzeichneten Stavanger Erklärung werden grundsätzliche kritische Überlegungen für die Verwendung digitaler Medien im Schulunterricht aber auch für das private Lesen zu Hause formuliert. Im Mittelpunkt der Erklärung stehen Fragen für welche Lesekontexte und bei welchen Lesern der Einsatz digitaler Texte den größten Nutzen verspricht? Aber auch in welchen Bereichen des Lernens und literarischen Schreibens das Medium Papier gefördert und bevorzugt werden sollte.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die digitale Welt zu einem festen Bestandteil der kindlichen und jugendlichen Entwicklung geworden ist und bei der Frage, ob Lesen und Schreiben besser analog oder digital erlernt und gefördert werden soll, nur mehr ein gezieltes sowohl als auch möglich ist. Auch die digitale Welt wird eine lesende Welt bleiben und digitale Medien, digitales Lesen und Schreiben allein durch ihre gesellschaftliche Durchdringung, zwangsläufig von selbst Teil des schulischen Lebens geworden ist. Für den Lese- und Schreibunterricht bleibt es dafür umso wichtiger, die spezifischen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie für die jeweiligen Entwicklungsstufen zu berücksichtigen.
Digitale Medien, wenn sie didaktisch gezielt in einen hochwertigen Unterricht eingebettet werden, bieten die Möglichkeit, Lernangebote zu differenzieren und individualisieren und damit dem Sprachunterricht zusätzliche Möglichkeiten zu eröffnen. Dazu können Apps helfen, eigene Texte zu produzieren und Programme den Schriftspracherwerb durch Sprach- oder Filmausgaben unterstützen und mit Vorlesefunktionen oder interaktiven Elementen die Lesemotivation erhöhen. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 72)
Für einen sinnvollen Einsatz digitaler Medien im Unterricht zählt grundsätzlich nur, wie sie pädagogisch und didaktisch eingesetzt werden, um den Lernerfolg der Schüler zu erhöhen. Lernprogramme und digitale Aufgaben müssen in diesem Sinn eine reine Routinehandlung überschreiten, eine vertiefende Auseinandersetzung anregen und Transferleistungen ermöglichen.
Digitale Lesemedien für Kinder im Vorschulalter
Die Fähigkeit, Texte beim Lesen zu verstehen, entwickelt sich bereits im Vorschulalter und reicht über die Grundschulzeit hinaus. Die Wissenschaft erkennt darin eine sich aufbauende Kompetenz sprachverarbeitender Fähigkeiten verbunden mit Dekodier- und Wortlesefähigkeiten. Bereits im Vorschulalter entwickeln sich viele Vorläuferfähigkeiten wie Wortschatz, Grammatik, textrelevantes Vorwissen, ein verbales Arbeitsgedächtnis oder phonologisches Bewusstsein. Diese Fähigkeiten werden durch frühes Vorlesen und gemeinsame Lesen von Eltern und Kind gefördert. Aber nicht nur die Häufigkeit, sondern auch die Qualität des Vorlesens sowie das dazugehörige Gespräch zwischen Eltern und Kind sind von entscheidender Bedeutung.

Lesen mit digitalen Kinderbüchern bringt auch Vorteile
mit sich. Wichtig bleibt das Gespräch mit Erwachsenen.
Metastudien haben gezeigt, dass das Lesen elektronischer Kinderbücher mit multimedialen Elementen, wie z.B. Sound-Effekten, Animationen oder Videos, verglichen mit gewöhnlichen Büchern ohne Effekte kleine Vorteile bei Verständnis und Wortschatz erkennen lassen.
Erhalten die Kinder beim Lesen des Printformates keine Unterstützung durch Erwachsene, ergeben sich für elektronische Kinderbücher sogar klare Vorteile, während sich bei Unterstützung keine Unterschiede zeigen. Elektronischen Kinderbüchern kann somit eine wichtige Bedeutung zukommen kann, wenn Eltern wenig oder gar nicht mit ihren Kindern gemeinsam lesen.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass elektronische Kinderbücher mit spezifisch multimedialen Merkmalen wie Animationen oder Sound-Effekte sich zwar positiv auswirken, hingegen Kinderbücher mit interaktiven Elementen, wie ergänzende Fragen oder Spiele, keinen lernfördernden Effekt zeigen. Die interaktiven Elemente lenken von der Geschichte ab, überlasten das Gedächtnis und behindern somit das Lernen. Als Problem zeigt sich, dass die pädagogische Qualität eines Großteils der erhältlichen Lernförder-Apps zu wünschen übriglässt und bei den kostenfreien Apps zusätzlich die ablenkende Werbung stört.
Individualisierung und Differenzierung beim Erlernen der Schriftsprache
Beim Schulbeginn besteht grundsätzlich das Problem, dass nicht alle Kinder den gleichen Entwicklungsstand ihrer Fertigkeiten, Fähigkeiten und sprachlichen Kompetenzen aufweisen. Damit starten sie mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Erfahrungen in ihr Schulleben. Hier bietet sich in der Grundschule mit Hilfe digitaler Medien die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen und individuelle Fördermaßnahmen für Kinder zu entwickeln.
Mit den gängigen Schulbüchern lässt sich der Umfang und der Schwierigkeitsgrad der Lernaufgaben für verschiedene Schüler steuern. Im Bereich Lesen gibt es durch Texte und Aufgabenstellungen in normaler und einfacher Sprache, die Möglichkeit, trotz unterschiedlicher Anforderungen in Form von Textumfang, Wortschatz und Satzstruktur, im Unterricht mit allen Kindern die gleichen Aufgaben zu bearbeiten und über den gleichen Inhalt sprechen.
Mit Hilfe digitaler Medien und KI gesteuerter Systeme lassen sich individualisierte Lernangebote erstellen, um unterschiedliche Lernniveaus zu berücksichtigen. Individuell angelegte Profile sammeln die Lernfortschritte und Lernziele und zeigen die Stärken, Schwächen und Bedürfnisse der Schüler auf. Diese Daten, die für alle Akteure zur Verfügung gestellt werden können, bilden die Grundlage für individuelle Förderungen wie für Gespräche mit Schülern und Eltern. Digitale Endgeräte unterstützen eine flexible Arbeitsumgebungen, in der die Schüler Zeit und Ort für die Bearbeitung der Aufgaben selbst wählen können.
Zudem bieten KI-Systeme die Möglichkeit eines unmittelbaren Feedbacks mit sofortiger Fehlerkorrektur und Hinweisen zur Verbesserung, was für ein kontinuierliches Lernen und die Selbstkontrolle von besonderer Bedeutung ist.

In der Grundschule bieten digitale Medien die Möglichkeit,
unterschiedlichen Voraussetzungen durch individuelle
Fördermaßnahmen gerecht zu werden.
Auch für das Schreibenlernen gibt es mittlerweile technische Hilfsmittel, wie digitalisierte Stifte für Tablet oder Touchdisplay bzw. Stifte mit Sensoren, die Bewegungsdaten beim Schreiben auf Papier erfassen und digital umsetzen können.
Mithilfe der KI lassen sich gezielt individualisierte Übungen ausarbeiten, die dabei helfen können, die Schreibfertigkeiten zu verbessern. So lassen sich Texte für den Erstlese- oder Literaturunterricht in leichte Sprache umwandeln und somit für verschiedene Lesekompetenzen Übungen und Aufgaben für die gleichen Inhalte konzipieren.
Im Bereich des Fremd- oder Zweitsprachenunterrichts lassen sich mit Hilfe der KI für neue Wörter oder Phrasen unterstützende Materialien erstellen, die auch bei der richtigen Aussprache und Worterkennung helfen. Neben dem Schreiben und Lesen können auch Übungen erarbeitet werden, um Grammatik, Satzbau, Schreibstil u.a. zu verbessern. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 95-104)
Kriterien für digitale Tools für das Lesen- und Schreibenlernen
Digitale Tools im Schul- und Bildungskontext sind Software-Anwendungen, die gezielt für den Bildungsbereich konzipiert sind. Leselern-Tools sollen den Leseerwerb in seinen unterschiedlichen Phasen und Herausforderungen wie dem Entschlüsseln von Wörtern oder beim Erfassen eines Textes angeleitet unterstützen. Durch die enge Verknüpfung von Lesen- und Schreibenlernen macht auch der Einsatz kombinierter Tools Sinn.
Die Tools sollen sich an Lehr- und Bildungsplänen und -standards orientieren und deren didaktische und pädagogische Prinzipien umsetzen. Dabei gilt es, die Übungen in einen motivierenden Kontext zu stellen, mit dem sich die Kinder identifizieren können und sie zu Aktivität anregen.
Inhaltlich wird von den Tools ein hoher Grad an Interaktivität gefordert, um das Verstehen, Einprägen, Abrufen und Anwenden des Gelernten sicherzustellen. Die Arbeitsaufträge müssen verständlich sein und wenn möglich auch akustisch und visuell aufbereitet sein. Lern- und Spielelemente sollten in einem pädagogisch sinnvollen Verhältnis stehen.

Leselern-Tools sollen den Leseerwerb in seinen
unterschiedlichen Phasen unterstützen.
Digitale Tools bieten gegenüber dem üblichen Lernen im Schulalltag erhebliche Vereinfachungen in Bezug auf die Individualisierung und Differenzierung von Lerneinheiten, Übungen und Aufgaben. Gute Tools bieten außerdem die Möglichkeit, sich an den individuellen Lernfortschritt, den Lernstil sowie Bedürfnisse und Fähigkeiten anzupassen.
Eines der wichtigsten Merkmale eines effektiven Lerntools für ein nachhaltiges Lernen ist das individuelle Feedback. Dafür braucht es didaktisch sinnvolle Rückmeldungen, die individuelle Probleme diagnostizieren und darauf mit gezielten Förderübungen reagieren können. Die Rückmeldungen sollten unmittelbar erfolgen, die Fehler korrigieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.
Weitere Kriterien sind die Benutzerfreundlichkeit, die eine intuitive Bedienung des Tools ermöglicht. Die Lerneinheiten und Aufgaben sollen animierend und nicht überfordernd sein und den Lehrpersonen und Erwachsenen Auskunft über den Lernstand des Kindes und über Fördermöglichkeiten geben. (Vgl. Knopf, Bd. 1, Theorie, S. 119-127)
Speziell für das Lesen werden verschiedene Anforderungen an digitale Leselern-Tools gestellt wie die Einhaltung der Leserichtung von links nach rechts sowie eine Vorlesefunktionen, um die richtige Sprechweise zu erlernen. Wie bei gedruckten Lesestoffen gilt es auch gezielt auf die angemessene Zeichen- und Textlänge sowie Komplexität zu achten. Auch die Schriftart sollte den Bedürfnissen der Grundschule angemessen sein, um die Lesbarkeit zu sichern. (vgl. Julia Knopf, Band 2 Praxis, S. 15-19)
Schreib- und Leselerntools wie Olchi ABC – Buchstabensuppe (3,99 €), Schreibreise (gratis),
Lesenlernen mit Zebra (4,99 €), Lesestart zum Lesenlernen (gratis), Der Löwe – ein Lese- und Schreibabenteuer (3,99 €) oder Li La Lolle (8,99 €) haben sich je nach den vorhandenen Fähigkeiten der Lerngruppen als mehr oder weniger geeignet gezeigt. Grundsätzlich wird festgehalten, die Tools zwar als Ergänzung den Schriftspracherwerb und die digitalen Kompetenzen fördern, das klassische Lesen- und Schreibenlernen im Unterricht aber nicht ersetzen können. (Vgl. Knopf, Band 2 Praxis, S. 20-33)
Hybride Lernsettings für den Schriftspracherwerb
Gemeint ist damit die Kombination analoger klassischer Lernmethoden des Lesen- und Schreibenlernens mit digitalen Lernübungen, bzw. Online-Unterricht, die sich auch orts- und zeitunabhängig durchführen lassen. Für diese Unterrichtsform sind die nötigen technischen Voraussetzungen und pädagogischen Vorbereitungen entscheidend. (Vgl. Knopf, Band 2 Praxis, S. 35-41)
Vorgestellt werden die Plattform „Learning Apps“ https://learningapps.org/, die Lern- und Lehrprozesse unterstützt und mit der sich kleine, interaktive, multimediale Lernbausteinen online erstellen lassen. „Make it“ ist eine Spiel- und Quiz-basierte Lernplattform, mit der Schüler im Unterricht oder zu Hause beschäftigen können. (Vgl. Knopf, Band 2 Praxis, S. 57-67)
Die deutsche Leseplattform „Lesen to go“ (Vgl. Knopf, Band 2 Praxis, S. 136-141) bietet zahlreiche Materialien zur Leseförderung um die Leseflüssigkeit, Lesegenauigkeit, den Wortschatz, das sinnentnehmende Lesen, die Lesegeschwindigkeit und die Lesemotivation zu verbessern. Die App „Einfach vorlesen!“ bietet Vorlesegeschichten für Kinder ab 3, 5 und ab 7 Jahren für das Smartphone, wobei jede Woche drei neue Kinderbuchgeschichten das kostenlose Angebot vergrößern.

Digitale Medien bieten zahlreiche interessante Möglichkeiten, können
aber den klassischen Unterricht und den Kontakt mit der Lehrperson
nicht ersetzen.
Auf „Lesejule“ findet sich kostenloses Lernmaterial zum Lesen und Schreiben lernen mit Übungen zu Lauten und Silben, erstes Lesen auf Wort- und Satzebene, einfache bis mittelschwere Texte, viele Rätsel und ein Online-Lernprogramm zum Einprägen von Schreibweisen in jeweils drei Schwierigkeitsstufen.
„Lesenlernen“ bietet Übungen und Materialien zur phonologischen Bewusstheit, zum Lernen von Buchstaben und Alphabet, zur Leseflüssigkeit, zum Leseverstehen und Wortschatz für Altersstufen vom Kindergarten, der Vorschule bis zur 4. Klasse der Grundschule.
Auf „Schule und Familie – Leseübungen für Grundschüler“ finden sich Arbeitsblätter zum gratis Download mit Leseübungen für die Klasse 1 bis 2 der Grundschule. Die Kopiervorlagen sollen helfen, die Welt der Buchstaben und Worte zu entdecken und fließend sinnerfassendes Lesen zu fördern.
Für viele sogenannte digitale „Übungen“ ergibt sich bei näherer Betrachtung, dass sie mehr als „Überprüfung“ dienen, um einen Leistungsstand zu erfassen, aber keine Hilfestellung, Erklärung oder weitere differenzierende Übungen bieten. Die Wirksamkeit der Übungen und Übungsformate werden dabei meist unreflektiert übernommen wird. Als positiv für Lernende hingegen zeigt sich, dass Rückmeldungen unmittelbar automatisiert erfolgen.
Verwendete Literatur:
Julia Knopf / Eva Wagner (Hg.), Schriftspracherwerb und Digitalisierung. Band 1 Theorie
Julia Knopf / Eva Wagner (Hg.), Schriftspracherwerb und Digitalisierung. Band 2 Praxis
Linksammlung:
Literacy: Leitlinie zu qualitativen Anforderungen an Lesematerialien, Lesesoftware und deren adäquaten Einsatzmöglichkeiten im Unterricht
Bundesministerium für Bildung: #LesenDigital Leseförderung in einem digitalisierten Unterricht
Leseforum.ch: Gerda Kysela-Schiemer, Lesen und digitale Medien
Universität Wien: Schreiben und Lesen lernen mit digitalen Medien
Lesen.Bayern: Stavanger Erklärung
Stavanger Declaration
Lesen to go!
Wiener Schulschrift
Der Standard: Wiens Kinder bekommen eine neue Schulschrift
BR: Eindeutige Studien: Darum ist es gut, mit der Hand zu schreiben
Andreas Markt-Huter, 05-11-2025
