Anna Kim, Die große Heimkehr
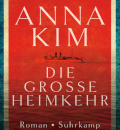 Historische Romane benützen oft nur minimale Erzähl-Stäbchen, um den Leser sauber mit dem fetten Stoff in Verbindung zu bringen und eine generelle Verdauung auszulösen.
Historische Romane benützen oft nur minimale Erzähl-Stäbchen, um den Leser sauber mit dem fetten Stoff in Verbindung zu bringen und eine generelle Verdauung auszulösen.
Anna Kim wählt eine Erzählerin, die im Europa der Gegenwart adoptiert und verortet ist und erstmals nach Korea fährt, von wo aus sie als Kind fortgetragen worden ist. Die Erzählerin der Gegenwart trifft auf den alten Yunhoo, der in die 1950er und 1960er Jahre zurückblendet, wo sich das Wesen Koreas maßgeblich verändert hat. Wir europäischen Leser sind zwar täglich auf der Straße und im Netz mit südkoreanischer Hardware unterwegs, wissen von den Bewohnern aber nur, dass sie ein anstrengendes Bildungssystem haben, das gerne im Suizid endet.

 Die Liebe kann neben allerhand Störungen oder Zauberkräften auch eine satte Identitätskrise auslösen.
Die Liebe kann neben allerhand Störungen oder Zauberkräften auch eine satte Identitätskrise auslösen.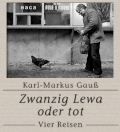 Ein hoher Witz muss sein: Beim Gaußschen Gesetz wird der elektrische Fluss durch eine geschlossene Fläche vermessen, bei der Gaußschen Landkarte kommen Gegenden in peripherer Lage in den Fokus von Geschichte.
Ein hoher Witz muss sein: Beim Gaußschen Gesetz wird der elektrische Fluss durch eine geschlossene Fläche vermessen, bei der Gaußschen Landkarte kommen Gegenden in peripherer Lage in den Fokus von Geschichte.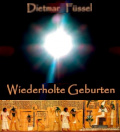 Der Titel ist höchst hinterlistig gewählt, es kann sich um mehrere Geburten handeln, die anfallen, aber auch um falsche oder ungültige, die wiederholt werden müssen.
Der Titel ist höchst hinterlistig gewählt, es kann sich um mehrere Geburten handeln, die anfallen, aber auch um falsche oder ungültige, die wiederholt werden müssen. Eine Zeitschrift nach einem Berg zu benennen, ist nie falsch. Zumindest Begriffe wie stabil, zeitlos und offen lassen auf ein Konzept schließen, wonach man mit Weitblick eine regionale Kultur zu bestreichen gedenkt. Arunda ist ein Berg in der Nähe von Mals Richtung Grenzgebiet zur Schweiz, von wo aus man an guten Tagen gute Sicht auf den Vinschgau hat.
Eine Zeitschrift nach einem Berg zu benennen, ist nie falsch. Zumindest Begriffe wie stabil, zeitlos und offen lassen auf ein Konzept schließen, wonach man mit Weitblick eine regionale Kultur zu bestreichen gedenkt. Arunda ist ein Berg in der Nähe von Mals Richtung Grenzgebiet zur Schweiz, von wo aus man an guten Tagen gute Sicht auf den Vinschgau hat. Das Siegesdenkmal steht zwar in Bozen, beschäftigt aber wie jedes gute Denkmal das ganze Land, in diesem Falle ganz Tirol. Das Siegesdenkmal ist wie jedes gute Denkmal ständig vom Abriss bedroht und bringt dadurch ständig einen Diskurs auf die Beine. Abermals ein Beweis, dass es ein gutes Denkmal ist. Das Siegesdenkmal ist zur Zeit Anlass und Ort für eine denkwürdige Ausstellung, in der Macht, Herrschaft, Kultur, Baugeschichte und Gebrauch von Geschichte denkwürdig zum Ausdruck gebracht sind.
Das Siegesdenkmal steht zwar in Bozen, beschäftigt aber wie jedes gute Denkmal das ganze Land, in diesem Falle ganz Tirol. Das Siegesdenkmal ist wie jedes gute Denkmal ständig vom Abriss bedroht und bringt dadurch ständig einen Diskurs auf die Beine. Abermals ein Beweis, dass es ein gutes Denkmal ist. Das Siegesdenkmal ist zur Zeit Anlass und Ort für eine denkwürdige Ausstellung, in der Macht, Herrschaft, Kultur, Baugeschichte und Gebrauch von Geschichte denkwürdig zum Ausdruck gebracht sind. „Vor fünfzig Jahren herrschte Vollbeschäftigung, die Staatsverschuldung war zwanzig Jahre lang gesunken, der soziale und europäische Zusammenhalt war stärker als heute. Warum hat sich die Lage in Europa seither schleichend verschlechtert? Welche Einsichten braucht es, damit wir die gesellschaftliche Entwicklung nicht als »Sachzwang« erleben, sondern als gestaltbar, und zwar von uns selbst? Welche Wege führen aus der Krise?“ (9)
„Vor fünfzig Jahren herrschte Vollbeschäftigung, die Staatsverschuldung war zwanzig Jahre lang gesunken, der soziale und europäische Zusammenhalt war stärker als heute. Warum hat sich die Lage in Europa seither schleichend verschlechtert? Welche Einsichten braucht es, damit wir die gesellschaftliche Entwicklung nicht als »Sachzwang« erleben, sondern als gestaltbar, und zwar von uns selbst? Welche Wege führen aus der Krise?“ (9)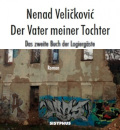 Begriffe geben manchmal vor, einen Sachverhalt darzustellen, und das Individuum ordnet sich meist diesen gängigen Bezeichnungen unter, damit eine Ruhe ist. In Wirklichkeit rumort es dann in den Helden weiter.
Begriffe geben manchmal vor, einen Sachverhalt darzustellen, und das Individuum ordnet sich meist diesen gängigen Bezeichnungen unter, damit eine Ruhe ist. In Wirklichkeit rumort es dann in den Helden weiter.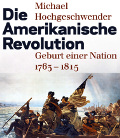 „Damit stellen sich die Demonstranten ganz bewusst und ohne jeden Selbstzweifel in die Tradition eines besseren, revolutionären Amerika, jener guten alten Zeit, als die USA noch weiß, protestantisch, tugendhaft, frei und voller Optimismus waren, einer Zeit allerdings, die so womöglich nie existiert hat.“ (7)
„Damit stellen sich die Demonstranten ganz bewusst und ohne jeden Selbstzweifel in die Tradition eines besseren, revolutionären Amerika, jener guten alten Zeit, als die USA noch weiß, protestantisch, tugendhaft, frei und voller Optimismus waren, einer Zeit allerdings, die so womöglich nie existiert hat.“ (7)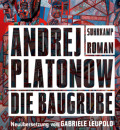 Ein Dreißigjähriger wird wegen wachsender Kraftschwäche entlassen, er geht nach draußen, um an der Luft besser seine Zukunft zu verstehen.
Ein Dreißigjähriger wird wegen wachsender Kraftschwäche entlassen, er geht nach draußen, um an der Luft besser seine Zukunft zu verstehen.