Andreas Maier, Die Heimat
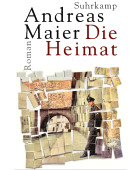 Vielleicht besteht die Heimat darin, dass ständig Menschen eingeheimatet werden. In der Tiroler Literatur jedenfalls werden ununterbrochen Schriftsteller eingemeindet, damit jene hohe Qualität gehalten werden kann, die von sogenannten Einheimischen allein nie getragen werden könnte.
Vielleicht besteht die Heimat darin, dass ständig Menschen eingeheimatet werden. In der Tiroler Literatur jedenfalls werden ununterbrochen Schriftsteller eingemeindet, damit jene hohe Qualität gehalten werden kann, die von sogenannten Einheimischen allein nie getragen werden könnte.
Andreas Maier gilt gemeinhin als der Schriftsteller der Wetterau. Diese Gegend hinter Frankfurt am Main hat er literarisch hoffähig und international bekannt gemacht. Das Schreiben perfektioniert hat er freilich während seiner Aufenthalte in Südtirol, wo er mit dem internationalen Provinzroman „Klausen“ (2002) eine unübersehbare Markierung gesetzt hat. Seit diesem Roman gilt er als Geheim-Tiroler mit allen Heimatrechten.

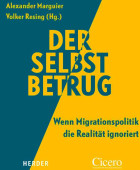 „Nach den schlimmen Erfahrungen der früheren Jahre wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die Asylrechte weit gefasst und im nationalen Recht verankert. Damit wurden die Menschenrechte zwar von einer abstrakten Idee zu einem einklagbaren Anspruch. Aber es blieb weiterhin ungeklärt, wie diese Ansprüche aufrechterhalten werden können, wenn der liberale Rechtsstaat nicht als Ziel aller gesellschaftlichen Entwicklung akzeptiert wird, und wie die Ansprüche erfüllt werden können, wenn sie massenhaft gestellt werden.“ (S. 18)
„Nach den schlimmen Erfahrungen der früheren Jahre wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die Asylrechte weit gefasst und im nationalen Recht verankert. Damit wurden die Menschenrechte zwar von einer abstrakten Idee zu einem einklagbaren Anspruch. Aber es blieb weiterhin ungeklärt, wie diese Ansprüche aufrechterhalten werden können, wenn der liberale Rechtsstaat nicht als Ziel aller gesellschaftlichen Entwicklung akzeptiert wird, und wie die Ansprüche erfüllt werden können, wenn sie massenhaft gestellt werden.“ (S. 18)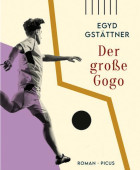 „Eine ruinierte Karriere ist noch kein zerstörtes Leben!“ (56) – Nirgends lässt sich der Sinn des Lebens besser suchen als auf den Spielfeldern Literatur und Fußball.
„Eine ruinierte Karriere ist noch kein zerstörtes Leben!“ (56) – Nirgends lässt sich der Sinn des Lebens besser suchen als auf den Spielfeldern Literatur und Fußball.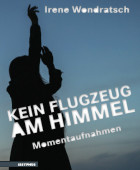 Dem Tagebuch ist es egal, was in der Welt draußen passiert, es schreibt sich zwischen den Buchdeckeln von selbst voll.
Dem Tagebuch ist es egal, was in der Welt draußen passiert, es schreibt sich zwischen den Buchdeckeln von selbst voll.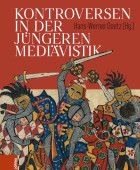 „Überblickt man das vorgeführte, noch höchst unvollständige und oft nur angedeutete Spektrum, dann haben Kontroversen unterschiedliche Entstehungsursachen: Sie resultieren, als Debatten zwischen Weiterentwicklung und Beharren, teils aus dem Wandel der Geschichtswissenschaft bzw. der Mediävistik und somit auch aus dem Zeitgeist, aus veränderten Bedürfnissen und anderen Fragestellungen, die zum Widerspruch derer führen, die am Bisherigen festhalten […], teils aber auch aus dem Anspruch neuer Richtungen, die Geschichtswissenschaft insgesamt zu bestimmen.“ (S. 46)
„Überblickt man das vorgeführte, noch höchst unvollständige und oft nur angedeutete Spektrum, dann haben Kontroversen unterschiedliche Entstehungsursachen: Sie resultieren, als Debatten zwischen Weiterentwicklung und Beharren, teils aus dem Wandel der Geschichtswissenschaft bzw. der Mediävistik und somit auch aus dem Zeitgeist, aus veränderten Bedürfnissen und anderen Fragestellungen, die zum Widerspruch derer führen, die am Bisherigen festhalten […], teils aber auch aus dem Anspruch neuer Richtungen, die Geschichtswissenschaft insgesamt zu bestimmen.“ (S. 46)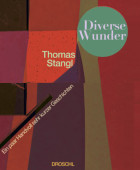 „Es ist kein Verdienst, diesen Ort erfunden zu haben, zufällig bewohne ich diesen Ort.“ (9) – Endlich einmal wird durch diverse Wunder unser auf uns selbst fixiertes Wissen durcheinandergebracht und an einem bislang unbekannten Ort neu aufgesetzt.
„Es ist kein Verdienst, diesen Ort erfunden zu haben, zufällig bewohne ich diesen Ort.“ (9) – Endlich einmal wird durch diverse Wunder unser auf uns selbst fixiertes Wissen durcheinandergebracht und an einem bislang unbekannten Ort neu aufgesetzt. Lesen ist für die meisten so selbstverständlich wie Nicht-lesen, es ist in der Öffentlichkeit vorhanden wie das Radfahren oder Fußgehen. Und nur wenn man es gezielt thematisiert, überlegen die Angesprochenen, dass sie vielleicht wieder einmal ein Buch durchblättern könnten.
Lesen ist für die meisten so selbstverständlich wie Nicht-lesen, es ist in der Öffentlichkeit vorhanden wie das Radfahren oder Fußgehen. Und nur wenn man es gezielt thematisiert, überlegen die Angesprochenen, dass sie vielleicht wieder einmal ein Buch durchblättern könnten. Die Originalgeschichte von „Max und Moritz“ aus dem Jahre 1865 versetzt noch immer die Pädagogenschaft in Rage und die Lausbuben und Lausmädchen in Verzückung. Im Stile einer Terror-Fibel nämlich werden der Gesellschaft ihre kleinbürgerlichen Privilegien um die Ohren geknallt, während diese mit einem kleingeistigen Curriculum versucht, den Kids den scharfen Zahn für die Zukunft zu ziehen. Als Max und Moritz den Lehrer sprengen, indem sie sich an seiner Lustpfeife vergreifen, ist Schluss mit lustig. Die Helden werden zynisch zu Tierfutter vermahlen und dem Federvieh als Kraftnahrung vorgesetzt.
Die Originalgeschichte von „Max und Moritz“ aus dem Jahre 1865 versetzt noch immer die Pädagogenschaft in Rage und die Lausbuben und Lausmädchen in Verzückung. Im Stile einer Terror-Fibel nämlich werden der Gesellschaft ihre kleinbürgerlichen Privilegien um die Ohren geknallt, während diese mit einem kleingeistigen Curriculum versucht, den Kids den scharfen Zahn für die Zukunft zu ziehen. Als Max und Moritz den Lehrer sprengen, indem sie sich an seiner Lustpfeife vergreifen, ist Schluss mit lustig. Die Helden werden zynisch zu Tierfutter vermahlen und dem Federvieh als Kraftnahrung vorgesetzt. Gleich zu Beginn sprengt sich eine Geburtstagsgesellschaft feierlich in einen Rausch, am Schluss, in der Stunde Null, stellt sich heraus, dass sich das ganze Land touristisch einwandfrei in die Luft gejagt hat. Sogar die felsenfesten Berge beginnen ob dieses Desasters zu tanzen und hinterlassen zerfallenes Gestein und zerbröselte Schicksale.
Gleich zu Beginn sprengt sich eine Geburtstagsgesellschaft feierlich in einen Rausch, am Schluss, in der Stunde Null, stellt sich heraus, dass sich das ganze Land touristisch einwandfrei in die Luft gejagt hat. Sogar die felsenfesten Berge beginnen ob dieses Desasters zu tanzen und hinterlassen zerfallenes Gestein und zerbröselte Schicksale.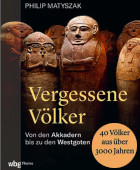 „Dieses Buch handelt von Völkern, die uns, auch wenn sie überwiegend vergessen sind, bis heute indirekt prägen. Oder aber es geht um Völker, von denen wir uns noch an eine Einzelheit erinnern, während der Rest verschwunden ist. Was wissen wir schon von den Baktrern bis auf ihre zweihöckrigen Kamele? Oder von den Samaritanern, außer dass einer von ihnen barmherzig war?“ (S. 8)
„Dieses Buch handelt von Völkern, die uns, auch wenn sie überwiegend vergessen sind, bis heute indirekt prägen. Oder aber es geht um Völker, von denen wir uns noch an eine Einzelheit erinnern, während der Rest verschwunden ist. Was wissen wir schon von den Baktrern bis auf ihre zweihöckrigen Kamele? Oder von den Samaritanern, außer dass einer von ihnen barmherzig war?“ (S. 8)