Hans Platzgumer, Großes Spiel
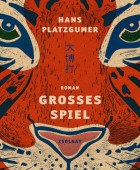 Wir feiern die verrücktesten Jubiläen, ohne oft genau zu wissen, welche Katastrophen und Kämpfe da dahinterstecken. Vor genau hundert Jahren, am 1. September 1923, wurde Tokio durch Brand und Erdbeben vernichtet. In einer dieser Erdbebenspalten verschwand auch das bisherige Regierungssystem und führte zu einem brutalen Machtkampf im Schatten des Kaisertums.
Wir feiern die verrücktesten Jubiläen, ohne oft genau zu wissen, welche Katastrophen und Kämpfe da dahinterstecken. Vor genau hundert Jahren, am 1. September 1923, wurde Tokio durch Brand und Erdbeben vernichtet. In einer dieser Erdbebenspalten verschwand auch das bisherige Regierungssystem und führte zu einem brutalen Machtkampf im Schatten des Kaisertums.
Hans Platzgumer greift diesen historisch und geographisch entlegenen Katastrophenfall auf, um durchzuspielen, wie sich Epochen an einer politischen Verwerfungskante reiben und Verwüstung anrichten.

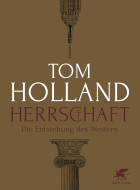 „Mein Buch untersucht, wodurch das Christentum so subversiv und revolutionär wurde; wie vollständig es die Grundhaltung der lateinischen Christenheit imprägnierte; und warum in einer westlichen Welt, die häufig ein so kompliziertes Verhältnis zu religiösen Ansprüchen hat, so viele ihrer Instinkte nach wie vor – im Guten wie im Schlechten – durch und durch christlich sind. Kurz: Es geht um die größte Geschichte aller Zeiten.“ (S. 27 f)
„Mein Buch untersucht, wodurch das Christentum so subversiv und revolutionär wurde; wie vollständig es die Grundhaltung der lateinischen Christenheit imprägnierte; und warum in einer westlichen Welt, die häufig ein so kompliziertes Verhältnis zu religiösen Ansprüchen hat, so viele ihrer Instinkte nach wie vor – im Guten wie im Schlechten – durch und durch christlich sind. Kurz: Es geht um die größte Geschichte aller Zeiten.“ (S. 27 f)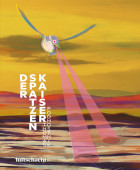 Für gewöhnlich läuft das Leben so dahin, ehe dann vielleicht ein Spatz vom Himmel fällt, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben.
Für gewöhnlich läuft das Leben so dahin, ehe dann vielleicht ein Spatz vom Himmel fällt, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben.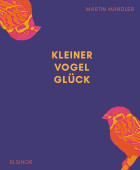 Wenn die Vögel aussterben, erfahren Romane mit dem Wort Vogel im Titel umso heftigere Aufmerksamkeit.
Wenn die Vögel aussterben, erfahren Romane mit dem Wort Vogel im Titel umso heftigere Aufmerksamkeit.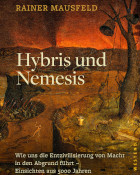 „Vor unendlich langer Zeit, in längst vergangenen Zeiten, die später als die goldene empfunden wurde, lebten die Menschen in Eintracht und Zufriedenheit. Vereinzelung oder gar ein Mehrhabenwollen auf Kosten anderer waren ihnen fremd. Als jedoch einige wenige anfingen, sich Vorteile auf Kosten der Gemeinschaft zu verschaffen, nahm die Geschichte ihren Lauf.“ (S. 10)
„Vor unendlich langer Zeit, in längst vergangenen Zeiten, die später als die goldene empfunden wurde, lebten die Menschen in Eintracht und Zufriedenheit. Vereinzelung oder gar ein Mehrhabenwollen auf Kosten anderer waren ihnen fremd. Als jedoch einige wenige anfingen, sich Vorteile auf Kosten der Gemeinschaft zu verschaffen, nahm die Geschichte ihren Lauf.“ (S. 10)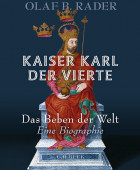 „Von Auserwähltheit geradezu «durchtränkt»: so möchte ich das Leben Karls in diesem Buch deuten und beschreiben. Seine Überzeugung, auserwählt zu sein, bedeutete ja nicht, dass sich der Monarch als passives Werkzeug des Herrn sah und sich in seinen Handlungen eigener Entscheidungen enthoben glaubte, sondern im Gegenteil, dass er mit seinen Fähigkeiten dem Willen Gottes Geltung verschaffen wollte, soweit es in seinen Kräften stand.“ (S. 20)
„Von Auserwähltheit geradezu «durchtränkt»: so möchte ich das Leben Karls in diesem Buch deuten und beschreiben. Seine Überzeugung, auserwählt zu sein, bedeutete ja nicht, dass sich der Monarch als passives Werkzeug des Herrn sah und sich in seinen Handlungen eigener Entscheidungen enthoben glaubte, sondern im Gegenteil, dass er mit seinen Fähigkeiten dem Willen Gottes Geltung verschaffen wollte, soweit es in seinen Kräften stand.“ (S. 20)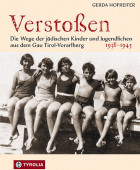 „Wer sind die „Helden“ der Geschichten? Weil im Gau Tirol-Vorarlberg relativ wenige Juden lebten, ist es möglich, einen kompletten Personenkreis zu erfassen und damit statistische Aussagen zu treffen. So kann man auch von einer leicht lesbaren Prosopografie sprechen. Es wurde ein Sample ausgewählt, das sich durch Ort und Zeit definiert und das nun 101 Personen umfasst …“ (S. 11)
„Wer sind die „Helden“ der Geschichten? Weil im Gau Tirol-Vorarlberg relativ wenige Juden lebten, ist es möglich, einen kompletten Personenkreis zu erfassen und damit statistische Aussagen zu treffen. So kann man auch von einer leicht lesbaren Prosopografie sprechen. Es wurde ein Sample ausgewählt, das sich durch Ort und Zeit definiert und das nun 101 Personen umfasst …“ (S. 11)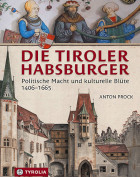 „Wer heute durch Innsbruck schlendert, stößt auf zahlreiche Erinnerungen an die einstigen Landesfürsten. Der Neuhof, verschiedene Klöster, der Vorgängerbau der heutigen Hofburg, Schloss Ambras, die Jesuitenkirche, die Mariahilfkirche, der Leopoldsbrunnen, das Grabmal Erzherzog Maximilians III. des Deutschmeisters im Dom sowie seine Eremitage im Kapuzinerkloster und vieles mehr zeugen von ihrer Herrschaft. (S. 8)
„Wer heute durch Innsbruck schlendert, stößt auf zahlreiche Erinnerungen an die einstigen Landesfürsten. Der Neuhof, verschiedene Klöster, der Vorgängerbau der heutigen Hofburg, Schloss Ambras, die Jesuitenkirche, die Mariahilfkirche, der Leopoldsbrunnen, das Grabmal Erzherzog Maximilians III. des Deutschmeisters im Dom sowie seine Eremitage im Kapuzinerkloster und vieles mehr zeugen von ihrer Herrschaft. (S. 8)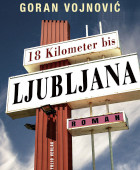 Wie viel Platz braucht eine Kultur, um Fuß zu fassen? Gibt es so etwas wie kreativ-tektonische Bodenplatten, die Kultur erzeugen, wenn sie aneinander reiben? Kann das Individuum seine Kultur selber wählen oder fällt diese einfach über einen her, wenn man bestimmten Boden betritt?
Wie viel Platz braucht eine Kultur, um Fuß zu fassen? Gibt es so etwas wie kreativ-tektonische Bodenplatten, die Kultur erzeugen, wenn sie aneinander reiben? Kann das Individuum seine Kultur selber wählen oder fällt diese einfach über einen her, wenn man bestimmten Boden betritt?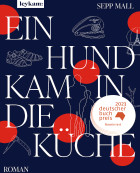 Bald werden wir wandern! – Ein Kind deutet die brutale Sprache der Erwachsenen immer so, dass es sich noch aushalten lässt. Der brachiale Begriff vom Auswandern wird für einen Augenblick gemildert, bis er vielleicht wieder von selbst verschwindet.
Bald werden wir wandern! – Ein Kind deutet die brutale Sprache der Erwachsenen immer so, dass es sich noch aushalten lässt. Der brachiale Begriff vom Auswandern wird für einen Augenblick gemildert, bis er vielleicht wieder von selbst verschwindet.