Konrad Paul Liessmann, Geisterstunde
 „Wie bei allen Phrasen besteht bei ihrem inflationären Gebrauch die Möglichkeit, dass sie nicht beim Wort genommen werden dürfen. Wie aber wäre es, wenn man einmal darüber nachdächte, inwiefern Bildung zum Glück der Menschen tatsächlich etwas beitragen kann?“ (7)
„Wie bei allen Phrasen besteht bei ihrem inflationären Gebrauch die Möglichkeit, dass sie nicht beim Wort genommen werden dürfen. Wie aber wäre es, wenn man einmal darüber nachdächte, inwiefern Bildung zum Glück der Menschen tatsächlich etwas beitragen kann?“ (7)
Was bedeutet es, wenn nicht mehr über Bildung, sondern nur mehr über deren Reform gesprochen wird, wenn nicht mehr Inhalte und Wissen sondern Kompetenzen vermittelt werden sollen, die sich allein am Maßstab der Nützlichkeit orientieren, der wiederum an den ständig wechselnden ökonomischen Bedürfnissen ausgerichtet wird?

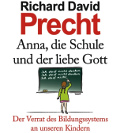 „Dieses Buch ist für Eltern geschrieben. Es möchte ihnen Argumente liefern, um gegen die bestehende Praxis aufzubegehren, die vielen von ihnen Kopfschmerzen bereitet und sie oft ohnmächtig zurücklässt.“ (10)
„Dieses Buch ist für Eltern geschrieben. Es möchte ihnen Argumente liefern, um gegen die bestehende Praxis aufzubegehren, die vielen von ihnen Kopfschmerzen bereitet und sie oft ohnmächtig zurücklässt.“ (10) „Österreich-Ungarn beschloß [sic!], mit der kriegslüsternen Leichtfertigkeit überalterter Kaiserreiche, die Gelegenheit dazu zu benutzen, sich Serbien einzuverleiben, wie es sich im Jahre 1909 Bosnien und die Herzegowina angeeignet hatte.“ (79)
„Österreich-Ungarn beschloß [sic!], mit der kriegslüsternen Leichtfertigkeit überalterter Kaiserreiche, die Gelegenheit dazu zu benutzen, sich Serbien einzuverleiben, wie es sich im Jahre 1909 Bosnien und die Herzegowina angeeignet hatte.“ (79)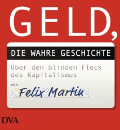 „Aber die Frage der Queen – Weshalb hat keiner der Ökonomen die Krise kommen sehen? – ist einfach. Deren wichtigstes Rahmenkonzept zum Verständnis der Makroökonomie ließ den Faktor Geld außer Betracht.“ (294)
„Aber die Frage der Queen – Weshalb hat keiner der Ökonomen die Krise kommen sehen? – ist einfach. Deren wichtigstes Rahmenkonzept zum Verständnis der Makroökonomie ließ den Faktor Geld außer Betracht.“ (294) Wie eine Gesellschaft tickt, kann man oft an ihrem Umgang mit sich selbst erkennen. Wie sorgen sich die Menschen um sich selbst? Welche Hilfsmittel verwenden sie? Wie schätzen sie ihre pflegenden Hände und Köpfe?
Wie eine Gesellschaft tickt, kann man oft an ihrem Umgang mit sich selbst erkennen. Wie sorgen sich die Menschen um sich selbst? Welche Hilfsmittel verwenden sie? Wie schätzen sie ihre pflegenden Hände und Köpfe?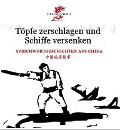 „Was soll das zum Beispiel heißen, wenn jemand vom Pferd aus Blumen betrachtet? Oder Töpfe zerschlägt und Schiffe versenkt? Um das zu verstehen, muss man die Geschichten kennen, die hinter diesen Redewendungen stecken.“ (7)
„Was soll das zum Beispiel heißen, wenn jemand vom Pferd aus Blumen betrachtet? Oder Töpfe zerschlägt und Schiffe versenkt? Um das zu verstehen, muss man die Geschichten kennen, die hinter diesen Redewendungen stecken.“ (7) „Eine geräuschlose Revolution? Ohne Kämpfe, ohne Umstürze, nur in Teilbereichen, eher unauffällig über einen langen Zeitraum: Kann das als die größte Revolution seit der Sesshaftwerdung der Menschheit in der Steinzeit […] gedeutet werden?“
„Eine geräuschlose Revolution? Ohne Kämpfe, ohne Umstürze, nur in Teilbereichen, eher unauffällig über einen langen Zeitraum: Kann das als die größte Revolution seit der Sesshaftwerdung der Menschheit in der Steinzeit […] gedeutet werden?“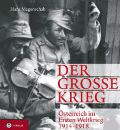 „Das Attentat von Sarajevo war der dilettantischste Tyrannenmord der Neuzeit; denn mit dem österreichischen Thronfolger starb der am wenigsten kriegsbesessene Politiker seiner Zeit – ohne Tyrann gewesen zu sein. Dass sich aus dem Gymnasiastenspiel am Veitstag ein Weltenbrand entwickeln könnte, hielten die Menschen anfangs für die unwahrscheinlichste Variante.“ (76)
„Das Attentat von Sarajevo war der dilettantischste Tyrannenmord der Neuzeit; denn mit dem österreichischen Thronfolger starb der am wenigsten kriegsbesessene Politiker seiner Zeit – ohne Tyrann gewesen zu sein. Dass sich aus dem Gymnasiastenspiel am Veitstag ein Weltenbrand entwickeln könnte, hielten die Menschen anfangs für die unwahrscheinlichste Variante.“ (76) „Unsere These ist: Das Arbeitsblatt ist eine mediale Revolution des Unterrichts, deren Bedeutung bis heute nicht angemessen reflektiert wurde – und deren Potential darum bis heute nicht ausgeschöpft wurde.“ (5)
„Unsere These ist: Das Arbeitsblatt ist eine mediale Revolution des Unterrichts, deren Bedeutung bis heute nicht angemessen reflektiert wurde – und deren Potential darum bis heute nicht ausgeschöpft wurde.“ (5)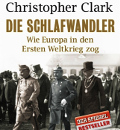 „So gesehen waren die Protagonisten von 1914 Schlafwandler – wachsam, aber blind, von Albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten.“ (718)
„So gesehen waren die Protagonisten von 1914 Schlafwandler – wachsam, aber blind, von Albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten.“ (718)