Hans Augustin, Der Fälscher
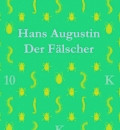 Die Fälscherei ist genaugenommen das größte Betätigungsfeld, das sich ein Mensch aussuchen kann. Denn in jedem Beruf, bei jedem Kunstwerk, in jeder Aussage kann es zu einer Fälschung kommen. Voraussetzung für eine gelungene Fälschung ist, dass man vom sogenannten Richtigen eine Ahnung hat.
Die Fälscherei ist genaugenommen das größte Betätigungsfeld, das sich ein Mensch aussuchen kann. Denn in jedem Beruf, bei jedem Kunstwerk, in jeder Aussage kann es zu einer Fälschung kommen. Voraussetzung für eine gelungene Fälschung ist, dass man vom sogenannten Richtigen eine Ahnung hat.
Hans Augustin legt seine Figuren immer an jene Kippe zwischen falsch und wahr, woran letztlich die Helden und die Leser gleichsam scheitern. Denn gerade die Wahrscheinlichkeit, dass das Wahre falsch ist und umgekehrt, macht eine eindeutige Erkenntnis schier unmöglich.

 Figuren aus der Mythologie tauchen gerne wie in der Spionageszene als Schläfer ab, ehe sie dann zu einem besonderen Anlass geweckt und zu einem frischen Einsatz gebracht werden.
Figuren aus der Mythologie tauchen gerne wie in der Spionageszene als Schläfer ab, ehe sie dann zu einem besonderen Anlass geweckt und zu einem frischen Einsatz gebracht werden.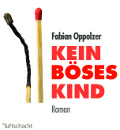 Kinder oder Hunde, die sich auffällig benehmen, werden gegenüber der Umwelt oft mit den Sätzen verteidigt, der tut nichts, der ist ein braver Hund, das ist kein böses Kind!
Kinder oder Hunde, die sich auffällig benehmen, werden gegenüber der Umwelt oft mit den Sätzen verteidigt, der tut nichts, der ist ein braver Hund, das ist kein böses Kind!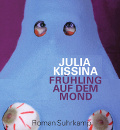 In der Literatur ist der Mond oft für jene Verhältnisse zuständig, die auf der Erde nicht möglich sind.
In der Literatur ist der Mond oft für jene Verhältnisse zuständig, die auf der Erde nicht möglich sind. Manche Titel brechen einem schon beim puren Vor-sich-hin-Murmeln das Herz, weil sie es in einer brutalen Silbenfolge so richtig sagen. „Brechen-brach-gebrochen“ erinnert an ungute Situationen, wo jemand vielleicht die Sprache lernen muss, während sie ihm ein anderer einprügelt und dadurch das Rückgrat bricht.
Manche Titel brechen einem schon beim puren Vor-sich-hin-Murmeln das Herz, weil sie es in einer brutalen Silbenfolge so richtig sagen. „Brechen-brach-gebrochen“ erinnert an ungute Situationen, wo jemand vielleicht die Sprache lernen muss, während sie ihm ein anderer einprügelt und dadurch das Rückgrat bricht.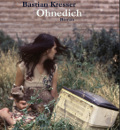 So wie in der Physik ein dreibeiniger Sessel etwas vom Stabilsten ist, was gegen das Wackeln hilft, ist in der Gefühls-Physik eine Dreierbeziehung etwas vom Instabilsten.
So wie in der Physik ein dreibeiniger Sessel etwas vom Stabilsten ist, was gegen das Wackeln hilft, ist in der Gefühls-Physik eine Dreierbeziehung etwas vom Instabilsten. Um mit der Vergangenheit zurechtzukommen, lässt eine Gesellschaft oft die Geschichte in Stein meißeln oder aus dem Stein wichtige Figuren als Denkmäler heraushauen. Lithops hingegen sind Pflanzen, die wie Stein ausschauen, aber lebendig sind. Eine ideale Metapher für das Wuchern von Geschichte.
Um mit der Vergangenheit zurechtzukommen, lässt eine Gesellschaft oft die Geschichte in Stein meißeln oder aus dem Stein wichtige Figuren als Denkmäler heraushauen. Lithops hingegen sind Pflanzen, die wie Stein ausschauen, aber lebendig sind. Eine ideale Metapher für das Wuchern von Geschichte.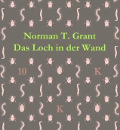 Spätestens seit der Geschichte mit dem tragbaren Loch von Paulchen Panther wissen wir, dass ein Loch in der Wand immer Ungemach bedeutet.
Spätestens seit der Geschichte mit dem tragbaren Loch von Paulchen Panther wissen wir, dass ein Loch in der Wand immer Ungemach bedeutet. Das Projekt die andere Geschichte geht in die zweite Runde. Sinn dieser Publikationen ist es, ein gemeinsames Auftreten unterschiedlichster Autorinnen zu dokumentieren.
Das Projekt die andere Geschichte geht in die zweite Runde. Sinn dieser Publikationen ist es, ein gemeinsames Auftreten unterschiedlichster Autorinnen zu dokumentieren.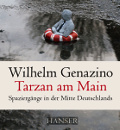 Während Tarzan wie selbstverständlich zur Liane greift, um von einem Hot-Spot des Dschungels zum nächsten zu schwingen, greift ein Autor zum essayistischen Erlebnisbericht, wenn er sich durch den Dschungel einer Stadt zu schwingen hat.
Während Tarzan wie selbstverständlich zur Liane greift, um von einem Hot-Spot des Dschungels zum nächsten zu schwingen, greift ein Autor zum essayistischen Erlebnisbericht, wenn er sich durch den Dschungel einer Stadt zu schwingen hat.