Günter Eichberger, Fragmente einer anarchistischen Poetik
 Wahrscheinlich ist jede Auseinandersetzung mit Literatur, insbesondere beim Rezensieren, ein Anstreifen an die Anarchie. Zumindest sind oft die an der Literatur beteiligten Protagonisten ausgewiesene Anarchen. Während aber die Anarchie, vulgär formuliert, so gut wie jegliche Herrschaft über einen selbst und das Werk ablehnt, ist der Anarch, romantischer formuliert, ein durch und durch unabhängiges Wesen.
Wahrscheinlich ist jede Auseinandersetzung mit Literatur, insbesondere beim Rezensieren, ein Anstreifen an die Anarchie. Zumindest sind oft die an der Literatur beteiligten Protagonisten ausgewiesene Anarchen. Während aber die Anarchie, vulgär formuliert, so gut wie jegliche Herrschaft über einen selbst und das Werk ablehnt, ist der Anarch, romantischer formuliert, ein durch und durch unabhängiges Wesen.
Günter Eichberger ordnet seine Lektüren, Begegnungen und Forschungen mit „Anarchen Zeitgenossen“ wie Wolfgang Bauer oder Helmut Eisendle zu einer anarchistischen Poetik, freilich mit dem relativierenden Zusatz, dass es sich dabei um Fragmente handelt.

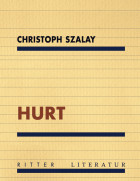 In goldenen Lettern prangt ein magischer Begriff vom Buchdeckel: HURT. In einer ersten Übersetzung stellt man sich etwas mit Verletzung und Schmerz vor. Und später wird klar, dass es sich um einen Zustand der Trance und der Körperverletzung handelt, wie er beispielsweise während eines Berglaufs auftreten kann.
In goldenen Lettern prangt ein magischer Begriff vom Buchdeckel: HURT. In einer ersten Übersetzung stellt man sich etwas mit Verletzung und Schmerz vor. Und später wird klar, dass es sich um einen Zustand der Trance und der Körperverletzung handelt, wie er beispielsweise während eines Berglaufs auftreten kann.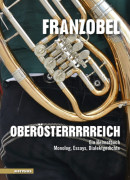 Das föderalistische System Österreichs bringt es mit sich, dass in der Literatur die Bundesländer schon seit Jahren in einem heimlichen Wettbewerb stehen, wer den groteskesten „Bundesländerroman“ zustande bringt. Dabei ist der Bundesländerroman zu einem eigenen Genre geworden, in dem sich ähnlich wie im Landkrimi eine Weltdramaturgie mit regionalen Absonderlichkeiten schmückt.
Das föderalistische System Österreichs bringt es mit sich, dass in der Literatur die Bundesländer schon seit Jahren in einem heimlichen Wettbewerb stehen, wer den groteskesten „Bundesländerroman“ zustande bringt. Dabei ist der Bundesländerroman zu einem eigenen Genre geworden, in dem sich ähnlich wie im Landkrimi eine Weltdramaturgie mit regionalen Absonderlichkeiten schmückt. Ein „fettes“ Buch über die Lebenszeiten verlangt gerade von Lesern im Dritten Lebensalter, schroff Rente genannt, vor allem Optimismus, dass sie das Buch noch in dieser Welt fertigkriegen. Andererseits gibt es über die Angehörigen dieser Kohorte einfach viel zu berichten, weil auch im einem schmalen Leben mit der Zeit viel passiert.
Ein „fettes“ Buch über die Lebenszeiten verlangt gerade von Lesern im Dritten Lebensalter, schroff Rente genannt, vor allem Optimismus, dass sie das Buch noch in dieser Welt fertigkriegen. Andererseits gibt es über die Angehörigen dieser Kohorte einfach viel zu berichten, weil auch im einem schmalen Leben mit der Zeit viel passiert.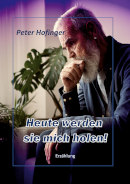 Die Befürchtung, geholt zu werden, überfällt in Romanen oft jene Helden, die am Ende sind. Bei Norbert Gstrein etwa wird im „Einer“ der sprachgestörte Jakob abgeholt, als er mit dem Dorfleben nicht zurecht kommt, in Texten nach der Machtübernahme der Nazis müssen Andersdenkende oft befürchten, geholt zu werden.
Die Befürchtung, geholt zu werden, überfällt in Romanen oft jene Helden, die am Ende sind. Bei Norbert Gstrein etwa wird im „Einer“ der sprachgestörte Jakob abgeholt, als er mit dem Dorfleben nicht zurecht kommt, in Texten nach der Machtübernahme der Nazis müssen Andersdenkende oft befürchten, geholt zu werden. In der Justiz stellen Tagsätze (Tagessätze) eine wesentliche Einheit zur gerechten Bemessung eines Strafausmaßes dar. Bei Schuldspruch wird man fallweise zu Tagessätzen verurteilt, damit soll sich die Strafe am Einkommen des Delinquenten orientieren.
In der Justiz stellen Tagsätze (Tagessätze) eine wesentliche Einheit zur gerechten Bemessung eines Strafausmaßes dar. Bei Schuldspruch wird man fallweise zu Tagessätzen verurteilt, damit soll sich die Strafe am Einkommen des Delinquenten orientieren. Biographien verlaufen selten geradlinig, an ihren krummen Windungen lagern sich meist unverwechselbare Begebenheiten ab. Die daraus wachsenden Shortstorys dienen in der Literatur als unverwechselbare Marker eines Lebens, ähnlich wie es für die Forensik die Fingerabdrücke sind.
Biographien verlaufen selten geradlinig, an ihren krummen Windungen lagern sich meist unverwechselbare Begebenheiten ab. Die daraus wachsenden Shortstorys dienen in der Literatur als unverwechselbare Marker eines Lebens, ähnlich wie es für die Forensik die Fingerabdrücke sind. In beinahe geheim überlieferten Lebenserfahrungen ist oft die Rede davon, dass die fettesten Gräser am Rande eines Feldes anzutreffen sind. Und auch im weiten Feld der Kultur gilt die Erfahrung, dass sich die essentiellen Dinge oft am Rand abspielen.
In beinahe geheim überlieferten Lebenserfahrungen ist oft die Rede davon, dass die fettesten Gräser am Rande eines Feldes anzutreffen sind. Und auch im weiten Feld der Kultur gilt die Erfahrung, dass sich die essentiellen Dinge oft am Rand abspielen.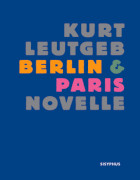 Seit der Literaturmarkt die einzelnen Werke verwechselbar macht und im Sinne der KI einheitliche Texte einfordert, müssen die letzten ums Lesen und Schreiben Kämpfenden neue Publikationsformen entwickeln. Der Sisyphus Verlag leistet sich dabei zwei Experimente. Im Falle von Ludwig Roman Fleischer werden etwa seine Werke in eine Themen-Trommel geschüttet und neu gemischt und verdichtet. Im Falle von Kurt Leutgeb werden unter dem Aspekt einer Gesamtausgabe mehrere Stufen der Edition eines Werks vorgestellt, dabei wird die Rezeptionsgeschichte wesentlicher Teil der Erzählung.
Seit der Literaturmarkt die einzelnen Werke verwechselbar macht und im Sinne der KI einheitliche Texte einfordert, müssen die letzten ums Lesen und Schreiben Kämpfenden neue Publikationsformen entwickeln. Der Sisyphus Verlag leistet sich dabei zwei Experimente. Im Falle von Ludwig Roman Fleischer werden etwa seine Werke in eine Themen-Trommel geschüttet und neu gemischt und verdichtet. Im Falle von Kurt Leutgeb werden unter dem Aspekt einer Gesamtausgabe mehrere Stufen der Edition eines Werks vorgestellt, dabei wird die Rezeptionsgeschichte wesentlicher Teil der Erzählung.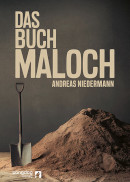 Andreas Niedermann arbeitet sich mit seinem Erzählband „Das Buch Maloch“ an allem ab, was direkt oder indirekt mit Arbeit zu tun hat. Mit diesem Unterfangen gleicht er dem großen soziologischen Projekt „Geschichte und Eigensinn“, worin Alexander Kluge und Oskar Negt 1981 eine ganze Generation von Arbeitern und Denkern in Atem gehalten haben.
Andreas Niedermann arbeitet sich mit seinem Erzählband „Das Buch Maloch“ an allem ab, was direkt oder indirekt mit Arbeit zu tun hat. Mit diesem Unterfangen gleicht er dem großen soziologischen Projekt „Geschichte und Eigensinn“, worin Alexander Kluge und Oskar Negt 1981 eine ganze Generation von Arbeitern und Denkern in Atem gehalten haben.