Valerie Fritsch, Winters Garten
 Seit Jahrhunderten gilt der Garten sowohl in seiner floristischen als auch in seiner literarischen Form als der Inbegriff für das Paradies.
Seit Jahrhunderten gilt der Garten sowohl in seiner floristischen als auch in seiner literarischen Form als der Inbegriff für das Paradies.
Valerie Fritsch stellt in ihrem Weltuntergangs-Roman „Winters Garten“ einen Anton Winter als Endzeithelden vor, der sich mit einem Garten noch eine Zeit lang hinaus rettet in den endgültigen Untergang.

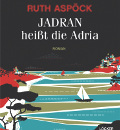 Bücher entstehen eher selten aus einem Überdruck, der durch das Schreibventil abgelassen wird. Meist sind Bücher das Ergebnis beharrlichen Sammelns von Notizen und deren Ausbreitung vor dem Leser unter dem Aspekt einer inneren Ordnung der Schreibenden.
Bücher entstehen eher selten aus einem Überdruck, der durch das Schreibventil abgelassen wird. Meist sind Bücher das Ergebnis beharrlichen Sammelns von Notizen und deren Ausbreitung vor dem Leser unter dem Aspekt einer inneren Ordnung der Schreibenden. In einem kulturellen Ambiente der Revivals und Remakes stellt sich durchaus die Frage, ob man den ganzen Schöpfungs-Semmel nicht ironisch neu deuten sollte.
In einem kulturellen Ambiente der Revivals und Remakes stellt sich durchaus die Frage, ob man den ganzen Schöpfungs-Semmel nicht ironisch neu deuten sollte.  Die schmerzhaftesten Gefühle lösen allemal die Heimat und die Liebe aus, zumal wenn sie nicht da sind. Aber auch ihr Vorhandensein kann die Helden ganz schön fordern.
Die schmerzhaftesten Gefühle lösen allemal die Heimat und die Liebe aus, zumal wenn sie nicht da sind. Aber auch ihr Vorhandensein kann die Helden ganz schön fordern.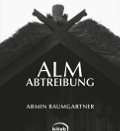 Idyllen schreien letztlich danach, dass sie aufgerissen oder zum Platzen gebracht werden. Ein Held tut sich eine Idylle nur an, weil er sich von ihr richtig demütigen lassen kann.
Idyllen schreien letztlich danach, dass sie aufgerissen oder zum Platzen gebracht werden. Ein Held tut sich eine Idylle nur an, weil er sich von ihr richtig demütigen lassen kann. Jeder Familienverband lebt davon, dass die einzelnen Mitglieder ein Narrativ entwickeln, worin geschönte Lebensläufe eine Art gelungenen Zusammenhalt zum Ausdruck bringen.
Jeder Familienverband lebt davon, dass die einzelnen Mitglieder ein Narrativ entwickeln, worin geschönte Lebensläufe eine Art gelungenen Zusammenhalt zum Ausdruck bringen. Was tut sich eigentlich täglich am Rand des Systems und kann man den Rand von der Mitte aus beschreiben oder gar verwalten?
Was tut sich eigentlich täglich am Rand des Systems und kann man den Rand von der Mitte aus beschreiben oder gar verwalten?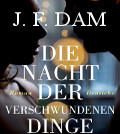 Es geht nicht um Gefühle, es geht um das Leben. – Nicht immer ist eine Generation imstande, ihre Absichten halbwegs klar zu formulieren.
Es geht nicht um Gefühle, es geht um das Leben. – Nicht immer ist eine Generation imstande, ihre Absichten halbwegs klar zu formulieren.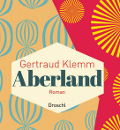 Je bürgerlicher und biedermeierlicher die Regeln sind, umso lautloser fällt das Aufbegehren gegen die Konvention aus. Der Widerstand spielt sich nur im Hinterkopf im Aberland ab, wo ab und zu zynische Formulierungen entstehen.
Je bürgerlicher und biedermeierlicher die Regeln sind, umso lautloser fällt das Aufbegehren gegen die Konvention aus. Der Widerstand spielt sich nur im Hinterkopf im Aberland ab, wo ab und zu zynische Formulierungen entstehen. Mit dem berühmten starken Anfangssatz brennt sich ein Roman unauslöschlich in das Gedächtnis der Leserschaft. „Jeden Sonntagmorgen, seit 1998, wachte Samuel Bly alleine auf und masturbierte.“ (9)
Mit dem berühmten starken Anfangssatz brennt sich ein Roman unauslöschlich in das Gedächtnis der Leserschaft. „Jeden Sonntagmorgen, seit 1998, wachte Samuel Bly alleine auf und masturbierte.“ (9)