Björn Bicker, Was wir erben
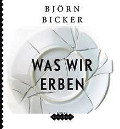 An manchen Tagen gibt es in der Literatur nur das Familienthema zu bearbeiten, die einen unternehmen alles, um die Familie los zu werden, die anderen alles, um sie zu entdecken.
An manchen Tagen gibt es in der Literatur nur das Familienthema zu bearbeiten, die einen unternehmen alles, um die Familie los zu werden, die anderen alles, um sie zu entdecken.
In Björn Bickers Roman „Was wir erben“ wird eine Ich-Erzählerin Elisabeth aus heiterem Himmel heraus dazu gezwungen, sich mit der Familie auseinanderzusetzen. Ihr ist nämlich ein Bild zugespielt worden, worauf zu erkennen ist, dass ihr Vater parallel zu seiner Frau eine Beziehung gehabt hat, aus der ebenfalls ein Kind übrig geblieben ist. Die Erzählerin schreibt dem etwa gleichaltrigen Halbbruder einen Brief und rollt ihre Hälfte des gemeinsamen Stammbaums auf.

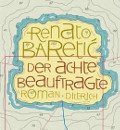 Die wahre Seele eines politischen Systems zeigt sich selten in der Hauptstadt sondern meist in vergessenen Randgebieten.
Die wahre Seele eines politischen Systems zeigt sich selten in der Hauptstadt sondern meist in vergessenen Randgebieten. Die Sprache ist schlauer als die Menschen, die sie benützen. Manchmal verzichtet sie gar auf die Menschen und erzählt selbst eine Geschichte.
Die Sprache ist schlauer als die Menschen, die sie benützen. Manchmal verzichtet sie gar auf die Menschen und erzählt selbst eine Geschichte. Der hundertste Geburtstag von Dichterinnen und Dichter ist für zeitlose Leser immer ein willkommener Anlass, deren Werk in der aktuellen Verankerung zu überprüfen durch Nachlesen.
Der hundertste Geburtstag von Dichterinnen und Dichter ist für zeitlose Leser immer ein willkommener Anlass, deren Werk in der aktuellen Verankerung zu überprüfen durch Nachlesen.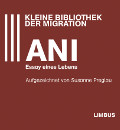 Bei besonderen Schicksalsschlägen gleicht sich auch die Sprache der Struktur eines solchen Lebens an und wird dadurch über die Zeiten hinweg unverwechselbar.
Bei besonderen Schicksalsschlägen gleicht sich auch die Sprache der Struktur eines solchen Lebens an und wird dadurch über die Zeiten hinweg unverwechselbar.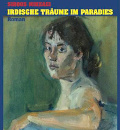 Der Sinn des Paradieses besteht darin, dass man es sich nicht vorstellen kann und darf. Sobald man ein Bild davon hat, ist es kein Paradies mehr. Dennoch muss das Paradies für diverse Religionen und politische Strömungen als ultimatives Ziel herhalten, man denke nur an diese fatale Märtyrer-Legende mit den tausend Jungfrauen.
Der Sinn des Paradieses besteht darin, dass man es sich nicht vorstellen kann und darf. Sobald man ein Bild davon hat, ist es kein Paradies mehr. Dennoch muss das Paradies für diverse Religionen und politische Strömungen als ultimatives Ziel herhalten, man denke nur an diese fatale Märtyrer-Legende mit den tausend Jungfrauen. Der Typenschein der „Flugblätter“ sagt es sehr genau: Lyrik kommt an gelungenen Tagen im Flug daher, Gedichte strömen durch die Zeit schwerelos wie die berüchtigten Blätter im Herbst, und eine politische Komponente darf im Zeitalter der Apps ebenfalls angenommen werden, Lyrik bringt zwischendurch auch Botschaften, die früher einmal im Zeitalter einer haptischen Öffentlichkeit über Flugblätter verbreitet worden ist.
Der Typenschein der „Flugblätter“ sagt es sehr genau: Lyrik kommt an gelungenen Tagen im Flug daher, Gedichte strömen durch die Zeit schwerelos wie die berüchtigten Blätter im Herbst, und eine politische Komponente darf im Zeitalter der Apps ebenfalls angenommen werden, Lyrik bringt zwischendurch auch Botschaften, die früher einmal im Zeitalter einer haptischen Öffentlichkeit über Flugblätter verbreitet worden ist.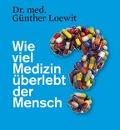 Die gewöhnlichste Lüge ist die, mit der man sich selbst belügt. Dieser lapidare Satz von Nietzsche lässt sich auch auf Systeme und Einrichtungen auslegen, Politik, Medizin und Bildung haben durchaus auch den Sack der Selbstlüge weit aufgemacht.
Die gewöhnlichste Lüge ist die, mit der man sich selbst belügt. Dieser lapidare Satz von Nietzsche lässt sich auch auf Systeme und Einrichtungen auslegen, Politik, Medizin und Bildung haben durchaus auch den Sack der Selbstlüge weit aufgemacht. Sogenannte Große-Bücher haben den Vorteil, dass sie ein ungeahnt weites Themen-Gebiet abdecken können und gleichzeitig die beschränkten Ressourcen der jeweiligen Anwenderinnen im Auge behalten.
Sogenannte Große-Bücher haben den Vorteil, dass sie ein ungeahnt weites Themen-Gebiet abdecken können und gleichzeitig die beschränkten Ressourcen der jeweiligen Anwenderinnen im Auge behalten. Die einzige Methode, das Leben zu meistern, besteht darin, den jeweils aktuellen Tag hinzukriegen. Dutzende Ratgeber stehen mit ihren Tipps Schlange beim ratlosen Leser, scheitern aber meist, weil sie die Sache zu ernst nehmen.
Die einzige Methode, das Leben zu meistern, besteht darin, den jeweils aktuellen Tag hinzukriegen. Dutzende Ratgeber stehen mit ihren Tipps Schlange beim ratlosen Leser, scheitern aber meist, weil sie die Sache zu ernst nehmen.