Julia Donaldson, Ponti Pento. Die Abenteuer eines Pinguins
 „Einst lebte mit etlichen Tanten so froh / das Pinguinkind Ponti Pento im Zoo. / Die Tanten erwähnten ein Land sehr weit draußen: / »Und dort, wo die Sonne stets scheint, ohne Pausen, / da watscheln gigantische Pinguinscharen / am Südpol im Schnee schon seit ewigen Jahren.«“
„Einst lebte mit etlichen Tanten so froh / das Pinguinkind Ponti Pento im Zoo. / Die Tanten erwähnten ein Land sehr weit draußen: / »Und dort, wo die Sonne stets scheint, ohne Pausen, / da watscheln gigantische Pinguinscharen / am Südpol im Schnee schon seit ewigen Jahren.«“
Der kleinen Ponti ist von den Geschichten der Tanten so angetan, dass er beschließt, dieses Land, wo immer die Sonne scheint und riesige Pinguinkolonien leben. zu finden. Und auch wenn der seine Tanten sehr lebt und sein Leben im Zoo genießt, nutzt er die erste Gelegenheit, um auszureißen und sich auf den Weg zum Südpol zu machen.

 Lyrik wird gespeist aus einem Befinden, das als Ur-Ozean bezeichnet wird. Der Essayist Alexander Kluge vermutet von diesem Urzustand, dass er den Subjekten eine stabile Körpertemperatur vermittelt, die ungefähr bei 37 Grad liegt.
Lyrik wird gespeist aus einem Befinden, das als Ur-Ozean bezeichnet wird. Der Essayist Alexander Kluge vermutet von diesem Urzustand, dass er den Subjekten eine stabile Körpertemperatur vermittelt, die ungefähr bei 37 Grad liegt.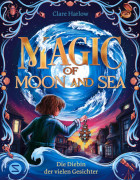 „Die Straße wurde Wandelgasse genannt, weil man niemals genau wusste, wo sie sich befand. Manche Menschen behaupteten, sie wären von einer seltsamen leisen Melodie zu ihrem Eingang geführt worden. Andere meinten, um sie aufzuspüren, müsse man sich lediglich an die Ecke zwischen Glockenstraße und Backhausgasse stellen und darauf warten, dass der Wind dreht. Aber Ista Flit war vollkommen klar, dass keiner dieser Menschen, die Gasse je betreten hatte.“ (S. 7)
„Die Straße wurde Wandelgasse genannt, weil man niemals genau wusste, wo sie sich befand. Manche Menschen behaupteten, sie wären von einer seltsamen leisen Melodie zu ihrem Eingang geführt worden. Andere meinten, um sie aufzuspüren, müsse man sich lediglich an die Ecke zwischen Glockenstraße und Backhausgasse stellen und darauf warten, dass der Wind dreht. Aber Ista Flit war vollkommen klar, dass keiner dieser Menschen, die Gasse je betreten hatte.“ (S. 7) „Meine Mutter ist gestorben, und alle sagen, dass ich nicht gut damit umgehe. Ich finde, müsste sich Sorgen machen, wenn es anders wäre. Also wenn ich feiern gehen oder Freunde einladen oder mich einfach ganz normal benehmen würde, denn niemand sollte sich normal benehmen, wenn einfach nichts normal ist.“ (S. 7)
„Meine Mutter ist gestorben, und alle sagen, dass ich nicht gut damit umgehe. Ich finde, müsste sich Sorgen machen, wenn es anders wäre. Also wenn ich feiern gehen oder Freunde einladen oder mich einfach ganz normal benehmen würde, denn niemand sollte sich normal benehmen, wenn einfach nichts normal ist.“ (S. 7)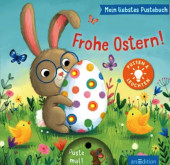 „Der Hase merkt am Ostermorgen: / Er muss die Eier noch besorgen! / Drum läuft er rasch zum Hühnerstall. Hier gibt es Eier überall. // Er bringt die Eier in den Bau. / Dort steh’n schon Farben - rot, gelb, blau - / und jedes Osterhasenkind / schwingt seinen Pinsel ganz geschwind.“
„Der Hase merkt am Ostermorgen: / Er muss die Eier noch besorgen! / Drum läuft er rasch zum Hühnerstall. Hier gibt es Eier überall. // Er bringt die Eier in den Bau. / Dort steh’n schon Farben - rot, gelb, blau - / und jedes Osterhasenkind / schwingt seinen Pinsel ganz geschwind.“ Mit zunehmendem Alter wird der Schreibtisch der Boomer und Beamten immer aufgeräumter. Letztlich bleibt nur ein Stehkalender übrig, der zu Ende geblättert ist.
Mit zunehmendem Alter wird der Schreibtisch der Boomer und Beamten immer aufgeräumter. Letztlich bleibt nur ein Stehkalender übrig, der zu Ende geblättert ist. „Aus einer Tür im Hügel drin, / im Herbst bei Wind und Wetter, / trat einmal ein kleiner Kerl, / es tanzten bunt die Blätter. // Du wirst ihn wohl auch sehen, / da oben, schau genau: / zwei Ohren, Wackelnäschen / und da blitzt etwas Blau …“
„Aus einer Tür im Hügel drin, / im Herbst bei Wind und Wetter, / trat einmal ein kleiner Kerl, / es tanzten bunt die Blätter. // Du wirst ihn wohl auch sehen, / da oben, schau genau: / zwei Ohren, Wackelnäschen / und da blitzt etwas Blau …“ „Ob Buch, Zeitung oder Internetformate: Medien informieren und manipulieren uns. In Zeiten von »Lügenpresse«-Vorwürfen bedarf es einer besonderen Verantwortung, um zur kritischen Auseinandersetzung mit Meinungsbildungsprozessen über Medien einzuladen. In diesem Buch wird es nicht primär um auffällige Fehlleistungen von Medien gehen, sondern um die gängige Konstruiertheit medial vermittelten Wissens mitsamt der möglichen Prägung von Vorstellungen.“ (S. 9)
„Ob Buch, Zeitung oder Internetformate: Medien informieren und manipulieren uns. In Zeiten von »Lügenpresse«-Vorwürfen bedarf es einer besonderen Verantwortung, um zur kritischen Auseinandersetzung mit Meinungsbildungsprozessen über Medien einzuladen. In diesem Buch wird es nicht primär um auffällige Fehlleistungen von Medien gehen, sondern um die gängige Konstruiertheit medial vermittelten Wissens mitsamt der möglichen Prägung von Vorstellungen.“ (S. 9) „Wenn Alice ganz still dastand, spürte sie abermals einen stetigen Herzschlag, diesmal durch ihre Fußsohlen. Sie kniete sich hin und legte beide Handflächen auf den ebenen Boden. Eine Spinne ließ sich an einem dünnen Seidenfaden herab und baumelte vor ihrem Gesicht, schien sie zu beobachten. Alice hielt erneut die Luft an, fühlte, wie es unter ihren Händen pulsierte und war sich nun ganz sicher: Dieser Herzschlag gehörte nicht zu ihr.“ (S. 40)
„Wenn Alice ganz still dastand, spürte sie abermals einen stetigen Herzschlag, diesmal durch ihre Fußsohlen. Sie kniete sich hin und legte beide Handflächen auf den ebenen Boden. Eine Spinne ließ sich an einem dünnen Seidenfaden herab und baumelte vor ihrem Gesicht, schien sie zu beobachten. Alice hielt erneut die Luft an, fühlte, wie es unter ihren Händen pulsierte und war sich nun ganz sicher: Dieser Herzschlag gehörte nicht zu ihr.“ (S. 40) In der Lyrik und in der Fotografie kommt es vor allem auf das Licht an. Beim ersten Einsetzen der Dämmerung lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Wie war das Licht des Tages und welche Bilder hat es zugelassen?
In der Lyrik und in der Fotografie kommt es vor allem auf das Licht an. Beim ersten Einsetzen der Dämmerung lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Wie war das Licht des Tages und welche Bilder hat es zugelassen?