Virginie Aladjidi, Lavendel, Lilie, Löwenzahn
 „Auf der Welt gibt es ungefähr 230000 Blütenpflanzen. Die meisten davon wachsen in tropischen Regenwäldern. In Europa unterscheidet man ungefähr 12000 Arten. Blütenpflanzen traten erstmals vor etwa 140 Millionen Jahren auf, also lange vor dem Menschen.“
„Auf der Welt gibt es ungefähr 230000 Blütenpflanzen. Die meisten davon wachsen in tropischen Regenwäldern. In Europa unterscheidet man ungefähr 12000 Arten. Blütenpflanzen traten erstmals vor etwa 140 Millionen Jahren auf, also lange vor dem Menschen.“
Auf 58 Bildtafeln werden auf einem Blumenspaziergang 66 Blütenpflanzen aus aller Welt, nach ihren Farben geordnet, vorgestellt. Dazu zählen Primelgewächse, wie die Schlüsselblume ebenso wie Korbblütler, zu denen Löwenzahn oder Sonnenblume gerechnet werden oder Liliengewächse wie die Tulpe.

 Der Sinn von Denkmälern muss immer wieder neu definiert werden, unbestritten sind diese Stelen, Figuren und Obelisken freilich als Orientierungshilfe bei der Müllentsorgung, als Treffpunkte für erotische oder psychodelische Rendezvous und schließlich als ideale Schauplätze für literarische Morde.
Der Sinn von Denkmälern muss immer wieder neu definiert werden, unbestritten sind diese Stelen, Figuren und Obelisken freilich als Orientierungshilfe bei der Müllentsorgung, als Treffpunkte für erotische oder psychodelische Rendezvous und schließlich als ideale Schauplätze für literarische Morde.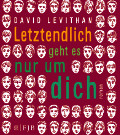 „Er steuert auf die Schule zu und kriegt nicht mit, dass ich praktisch vor ihm stehe. Ich könnte rufen, aber das mag er nicht. Das tun nur Mädels, die es nötig haben, sagt er – ständig nach ihren Freunden rufen. Es tut weh, dass er mich so sehr erfüllen kann und ich ihn so wenig.“
„Er steuert auf die Schule zu und kriegt nicht mit, dass ich praktisch vor ihm stehe. Ich könnte rufen, aber das mag er nicht. Das tun nur Mädels, die es nötig haben, sagt er – ständig nach ihren Freunden rufen. Es tut weh, dass er mich so sehr erfüllen kann und ich ihn so wenig.“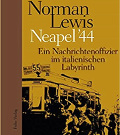 Reisebücher beschreiben meist ein Stück Geographie mit mehr oder weniger interessanten Menschen drin, eine spezielle Form ist jene, die dabei ein Stück Zeitgeschichte bereist.
Reisebücher beschreiben meist ein Stück Geographie mit mehr oder weniger interessanten Menschen drin, eine spezielle Form ist jene, die dabei ein Stück Zeitgeschichte bereist. „Aua! Hasenkind ist hingefallen! Hoffentlich ist nichts passiert. Lass uns mal schauen. Oje – voll auf den Arm, das tut weh!“
„Aua! Hasenkind ist hingefallen! Hoffentlich ist nichts passiert. Lass uns mal schauen. Oje – voll auf den Arm, das tut weh!“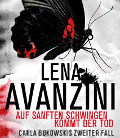 Wie Mais, Erz oder Altreifen werden Krimis mittlerweile als Massengut transportiert und in Tonnen abgerechnet. Dabei ist der Container noch die kleinste Abrechnungseinheit, es gibt Buchhandlungen, die ordern ganze Schiffsladungen von abgerundeten Krimis. Um in diesem Schüttgut den Überblick zu behalten, nummerieren die Autorinnen ihre Fälle durch, das hilft bei der Abrechnung, und auch die Leser sind froh, wenn sie sich eine Zahl merken können statt eines nichtssagenden Titels.
Wie Mais, Erz oder Altreifen werden Krimis mittlerweile als Massengut transportiert und in Tonnen abgerechnet. Dabei ist der Container noch die kleinste Abrechnungseinheit, es gibt Buchhandlungen, die ordern ganze Schiffsladungen von abgerundeten Krimis. Um in diesem Schüttgut den Überblick zu behalten, nummerieren die Autorinnen ihre Fälle durch, das hilft bei der Abrechnung, und auch die Leser sind froh, wenn sie sich eine Zahl merken können statt eines nichtssagenden Titels.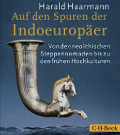 „Die meisten historischen und rezenten Weltsprachen, d. h. Sprachen mit globalem Kommunikationspotential, gehören genealogisch zur indoeuropäischen Sprachfamilie […]. Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte der indoeuropäischen Sprachen? Wo liegen ihre Ursprünge?“ (11)
„Die meisten historischen und rezenten Weltsprachen, d. h. Sprachen mit globalem Kommunikationspotential, gehören genealogisch zur indoeuropäischen Sprachfamilie […]. Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte der indoeuropäischen Sprachen? Wo liegen ihre Ursprünge?“ (11)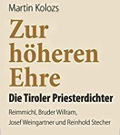 Manchmal sind es kleine Überlegungen, die eine große literaturhistorische Idee auf die Beine bringen. Lässt sich etwa die Tiroler Literatur dadurch beschreiben, dass in ihr immer wieder schizophrene Zwillinge als Priester und Dichter auftreten? Stark wäre diese Theorie, weil es ja eine gegenteilige Faustregel gibt: Die Religion verdunkelt, die Literatur erhellt!
Manchmal sind es kleine Überlegungen, die eine große literaturhistorische Idee auf die Beine bringen. Lässt sich etwa die Tiroler Literatur dadurch beschreiben, dass in ihr immer wieder schizophrene Zwillinge als Priester und Dichter auftreten? Stark wäre diese Theorie, weil es ja eine gegenteilige Faustregel gibt: Die Religion verdunkelt, die Literatur erhellt!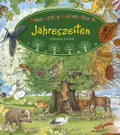 „April – Die Vögel bauen ihre Nester und beginnen zu brüten. Auch die Zugvögel sind jetzt alle wieder da. Schmetterlinge und Bienen erwachen und der Löwenzahn blüht.“
„April – Die Vögel bauen ihre Nester und beginnen zu brüten. Auch die Zugvögel sind jetzt alle wieder da. Schmetterlinge und Bienen erwachen und der Löwenzahn blüht.“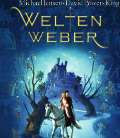 „Bosch hatte recht gehabt: Prinzessin Tyra war das bezauberndste Mädchen, das er je gesehen hatte. Nels erhob sich unwillkürlich, als hätte ihre Gegenwart ihn verhext und dazu gezwungen.“ (48)
„Bosch hatte recht gehabt: Prinzessin Tyra war das bezauberndste Mädchen, das er je gesehen hatte. Nels erhob sich unwillkürlich, als hätte ihre Gegenwart ihn verhext und dazu gezwungen.“ (48)