Jan David Zimmermann, Das Himmelsnetz
 Das Groteske erscheint einem oft als eine verzerrte Welt, gesehen vielleicht durch eine verkehrt aufgesetzte Lesebrille. Selbst wenn man den irritierten Blick korrigiert, ist es nicht mehr möglich, das Schräg-Gesehene ungeschehen zu machen.
Das Groteske erscheint einem oft als eine verzerrte Welt, gesehen vielleicht durch eine verkehrt aufgesetzte Lesebrille. Selbst wenn man den irritierten Blick korrigiert, ist es nicht mehr möglich, das Schräg-Gesehene ungeschehen zu machen.
Jan David Zimmermann wirft unter dem Titel „Das Himmelsnetz“ zwölf Geschichten aus, die vorbeikommende Leser rasch umgarnen. Auf Anhieb umarmen uns die Erzählungen mit Themen aus Kindertagen, als wir atemlos Bücher über fragile Schiffe, untergegangene Berufe und Fallstricke des Alltags gelesen haben.

 Wenn man die weite Welt nur eng genug fasst, hat man sie bald vollends im Griff und sie frisst einem aus der Hand. Alfred Paul Schmidt schrumpft in seinem Roman „Diese weite Welt“ das Universum auf die Stadt Graz herunter, der er den wundersamen Namen Schenn gibt, was schnell ausgesprochen etwa „schön“ bedeuten könnte. Und weil es so schön ist, heißt auch der Fluss Schenn, an den die Stadt angedockt hat.
Wenn man die weite Welt nur eng genug fasst, hat man sie bald vollends im Griff und sie frisst einem aus der Hand. Alfred Paul Schmidt schrumpft in seinem Roman „Diese weite Welt“ das Universum auf die Stadt Graz herunter, der er den wundersamen Namen Schenn gibt, was schnell ausgesprochen etwa „schön“ bedeuten könnte. Und weil es so schön ist, heißt auch der Fluss Schenn, an den die Stadt angedockt hat. „Zur weiteren Vorbereitung der Unternehmensgründung und des Achenseeprojekts konstituierte sich am 23. April 1924 in Wien in den Räumen der Allgemeinen Österreichi-schen Boden-Credit-Anstalt ein Interimskomitee der Tiroler Wasserkraftwerke AG (TI-WAG).“ (S. 39)
„Zur weiteren Vorbereitung der Unternehmensgründung und des Achenseeprojekts konstituierte sich am 23. April 1924 in Wien in den Räumen der Allgemeinen Österreichi-schen Boden-Credit-Anstalt ein Interimskomitee der Tiroler Wasserkraftwerke AG (TI-WAG).“ (S. 39) Ein ermunternder Zuruf an Beamte – was für ein frecher Titel! Christian Steinbachers Quellgebiet sind die Archive, Geheimdepots für Geschichten, Nachlässe von Eremiten und Tiefbohrungen in Wortschutzgebieten. Seine Gedichtbände gleichen Inventarverzeichnissen verschollener Texturen und poetischen Erkundungsstollen, weshalb der Band „Hoch die Ärmel“ auch mit der Genrebezeichnung „Gedichte“ und der Forschungsmethode „Schritte“ bezeichnet ist.
Ein ermunternder Zuruf an Beamte – was für ein frecher Titel! Christian Steinbachers Quellgebiet sind die Archive, Geheimdepots für Geschichten, Nachlässe von Eremiten und Tiefbohrungen in Wortschutzgebieten. Seine Gedichtbände gleichen Inventarverzeichnissen verschollener Texturen und poetischen Erkundungsstollen, weshalb der Band „Hoch die Ärmel“ auch mit der Genrebezeichnung „Gedichte“ und der Forschungsmethode „Schritte“ bezeichnet ist. Ein vielschichtiger Roman hat den Vorteil, dass man ihn nicht falsch lesen kann. Denn eine Komponente passt immer, und über diesen entgegenkommenden Weg öffnen sich bald auch die Seitenstränge und Querträger der Komposition.
Ein vielschichtiger Roman hat den Vorteil, dass man ihn nicht falsch lesen kann. Denn eine Komponente passt immer, und über diesen entgegenkommenden Weg öffnen sich bald auch die Seitenstränge und Querträger der Komposition. Der Bleistift hat es geschafft – er ist von einem Alltagsgegenstand zu einem Kultgerät geworden. Schriftsteller und Zeichner betreiben Podcasts und Foren, um sich über neueste Rituale rund um den Bleistift zu informieren.
Der Bleistift hat es geschafft – er ist von einem Alltagsgegenstand zu einem Kultgerät geworden. Schriftsteller und Zeichner betreiben Podcasts und Foren, um sich über neueste Rituale rund um den Bleistift zu informieren. Wie Lymphe ist in der Literatur neben den Texten ein zweiter Kreislauf angelegt, gleichsam ein Immun- und Heilsystem, worin all die Rezensionen und Lebenserfahrungen beim Lesen als echte Bücher vertrieben werden. Es macht nämlich einen profunden Unterschied, ob die Begleitliteratur knapp an der Grenze zum Alltagsgeschehen publiziert wird oder als Fließtext, der sich quasi über das Leben der Rezensierenden spannt.
Wie Lymphe ist in der Literatur neben den Texten ein zweiter Kreislauf angelegt, gleichsam ein Immun- und Heilsystem, worin all die Rezensionen und Lebenserfahrungen beim Lesen als echte Bücher vertrieben werden. Es macht nämlich einen profunden Unterschied, ob die Begleitliteratur knapp an der Grenze zum Alltagsgeschehen publiziert wird oder als Fließtext, der sich quasi über das Leben der Rezensierenden spannt.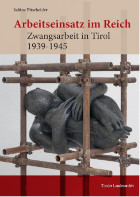 „Den maßgeblichen Rahmen, wer wie zu behandeln war, bot die »Rassenhierarchie«, wonach das NS-Regime Menschen je nach Herkunft oder Religion in bessere und schlechtere, wertvolle und »minderwertige« einteilte.“ (S. 51)
„Den maßgeblichen Rahmen, wer wie zu behandeln war, bot die »Rassenhierarchie«, wonach das NS-Regime Menschen je nach Herkunft oder Religion in bessere und schlechtere, wertvolle und »minderwertige« einteilte.“ (S. 51) Bücher, die ein extrem peripheres Sachgebiet abdecken, werden durch KI mittlerweile an den Mainstream angedockt, indem sachkundiges Bibliothekspersonal die entsprechenden Schlüsselbegriffe vernetzt. So tauchen scheinbar marginale Thesen eines Buches überraschend als Treffer an ganz anderer Stelle auf, wenn sie von einer Suchfunktion im Netz angesteuert werden.
Bücher, die ein extrem peripheres Sachgebiet abdecken, werden durch KI mittlerweile an den Mainstream angedockt, indem sachkundiges Bibliothekspersonal die entsprechenden Schlüsselbegriffe vernetzt. So tauchen scheinbar marginale Thesen eines Buches überraschend als Treffer an ganz anderer Stelle auf, wenn sie von einer Suchfunktion im Netz angesteuert werden.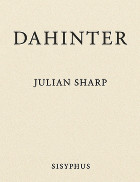 Im Daumenkino wird mit dem Daumen ein Packen Papier durchgeblättert, auf dem wie durch die Kader eines Filmes minimale Bewegungsabläufe sichtbar werden. Julian Sharp greift für seine Erzählung „Dahinter“ diese Idee auf, nur dass bei ihm die Bewegung existenziell sichtbar wird. Statt der gezeichneten Bilder verwendet er monomane Sätze, die die erzählte Geschichte wie die Spitzen einer Choreographie sichtbar werden lassen.
Im Daumenkino wird mit dem Daumen ein Packen Papier durchgeblättert, auf dem wie durch die Kader eines Filmes minimale Bewegungsabläufe sichtbar werden. Julian Sharp greift für seine Erzählung „Dahinter“ diese Idee auf, nur dass bei ihm die Bewegung existenziell sichtbar wird. Statt der gezeichneten Bilder verwendet er monomane Sätze, die die erzählte Geschichte wie die Spitzen einer Choreographie sichtbar werden lassen.